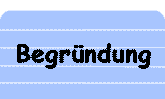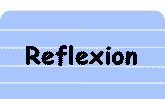4. Darstellung der Methode
4.1 Was ist Erlebnispädagogik?Eine Kajaktour mit teils hörgeschädigten Kindern und Jugendlichen, Skifahren mit der Schulklasse, Klettern, Segeln, Grenzerfahrung im Hochseilgarten, der alljährliche Wandertag einer nordrhein-westfälischen Grundschulklasse. Outdoor-Aktivitäten begegnen uns täglich und überall, sowohl innerhalb als auch außerhalb bestehender Institutionen wie Schule, Heim und Universität. Sportliches Erleben der (und in der) Natur ist aktuell im Trend; sehr beliebt sowohl als pädagogische Maßnahme bei Erziehungsschwierigen, als auch als gern gesehene Variante von Klassenfahrten oder Training für Manager. Auf der Suche nach einer Klärung des Begriffs Erlebnispädagogik begegnen wir einer Reihe von Erfahrungsberichten, Erläuterungen, Ratschlägen und Definitionsversuchen. Doch die Frage: Was ist genau gemeint unter Erlebnispädagogik? lässt sich selbst nach intensiver Lektüre nur schwer beantworten. Als Abgrenzung zu reinen Outdoor-Aktivitäten ist es sicherlich vorerst hilfreich, den pädagogischen Anspruch des Begriffs zu betonen. Er weist uns explizit darauf hin, dass in der Erlebnispädagogik gewisse Aktivitäten nicht rein um ihrer selbst Willen ausgeführt werden, sondern mit einer mehr oder minder ersichtlichen pädagogischen Zielsetzung verknüpft sind. Ist Erlebnispädagogik also gleichzusetzen mit Outdoor-Pädagogik? Diese Begriffe scheinen sich tatsächlich derzeit sehr nah zu sein, schließlich findet man bisher kaum erlebnispädagogische Berichte, die nicht mit Natursport zusammenhängen. Doch was ist mit Möglichkeiten des Erlebens und Lernens im städtischen Raum? Was mit Problemlöseaufgaben, die mit sportlicher Betätigung kaum oder nichts zu tun haben? Ab wann ist eine natursportliche Unternehmung wirklich als Erlebnispädagogik zu bezeichnen? Schließlich kann jedem Wandertag und jeder Oberstufen-Skifahrt eine gewisse pädagogische Absicht unterstellt werden, zumindest soweit, dass das Erleben von Bewegung, Natur und Gruppe per se einen nicht zu verleugnenden Einfluss auf Individuum und Gemeinschaft hat. Oder gehört mehr dazu, damit eine Aktivität als Erlebnispädagogik im Sinne einer exakteren Definition bezeichnet werden kann? Braucht es ein Konzept, verschiedene Techniken, Vor- und Nachbereitung und intensive Reflexion, damit aus bloßen Erlebnissen Erlebnispädagogik als (anerkannte) handlungsorientierte Methode wird? Im Folgenden sollen wichtige Merkmale, d.h. vor allem Gemeinsamkeiten erlebnispädagogischer Programme, aufgezeigt werden.
Handlungsorientierung Seit Anfang der 80ger Jahre erlebt die Erlebnispädagogik einen Boom, der auch gegenwärtig noch anhält. Daraus resultierend ergibt sich für eine Definition derzeit das Problem, dass aufgrund der expandierenden Zahl und Bandbreite von Anbietern und Angeboten ein einheitlicher Ansatz kaum auszumachen ist. Ein wichtiges Schlagwort, das bei aller Uneinheitlichkeit allen Ansätzen jedoch gemein ist, ist die Handlungsorientierung. Allerdings ist Erlebnispädagogik nur eine von vielen handlungsorientierten Methoden. Auch ist nicht jede handlungsorientierte Methode mit Erlebnispädagogik gleichzusetzen. Galuske spricht in diesem Zusammenhang von einer „Tendenz der Entgrenzung, wonach jedes Lernen in Lebenszusammenhängen bzw. jedes handlungsorientierte Lernarrangement als Erlebnispädagogik bezeichnet wird“ (Galuske 1999, 209). Ein anschauliches Beispiel liefern Heckmair/Michl: „Wenn konventionelle Führungen durch die Räumlichkeiten des Deutschen Bundestags vom dafür zuständigen Referenten als praktizierte Erlebnispädagogik bezeichnet werden, dann wird die ganze Diffusion und letztlich Konfusion um den immer noch schicken Erlebnisbegriff deutlich“ (Heckmair/Michl, 87).
Outdoor-Orientierung Ein weiteres wesentliches Merkmal, das sich immer wieder findet, scheint die Outdoor-Orientierung zu sein. Erlebnispädagogische Programme beziehen sich oft auf die natürliche Umwelt, teilweise wird damit ein ökologischer Bildungsanspruch verbunden. Nach Auffassung von Heckmair/Michl umfassen erlebnispädagogische Programme trotz des Schwerpunkts auf natursportlichen Aktivitäten inzwischen aber auch Projekte im urbanen Rahmen. Allein anhand der Begriffe Handlungs- und Outdoor-Orientierung lässt sich Erlebnispädagogik allerdings nur sehr unzureichend charakterisieren. Eine wesentlich umfassendere Beschreibung der Merkmale gibt die Definition von Hufenus, die Galuske in seinem Buch „Methoden der sozialen Arbeit“ zu Rate zieht: „Erlebnispädagogik ist eine Methode, die Personen und Gruppen zum Handeln bringt mit allen Implikationen und Konsequenzen bei möglichst hoher Echtheit von Aufgabe und Situation in einem Umfeld, das experimentierendes Handeln erlaubt, sicher ist und den notwendigen Ernstcharakter besitzt“ (Hufenus 1993, zitiert nach Galuske 1999, 210). Diese Definition versucht die Uneinheitlichkeit der Ansätze zu berücksichtigen, indem sie das Gemeinsame erlebnispädagogischer Ansätze betont. Gleichzeitig ist sie differenziert genug, um die Erlebnispädagogik von anderen handlungsorientierten Ansätzen abzugrenzen. Galuske (1999, S. 210f.) leitet aus dieser Definition fünf charakteristische Merkmale der Erlebnispädagogik ab, die sich auch bei vielen anderen Autoren in Variationen wieder finden:
1 Handlungsorientierung und Ganzheitlichkeit Auch als Abgrenzung zu rein theoretischen Formen des Lernens steht bei der Erlebnispädagogik „die tätige Auseinandersetzung mit einem Raum bzw. einer Aufgabe“ (Galuske 1999, 210) im Zentrum des Lernprozesses. Die jeweilige Aufgabe oder Situation macht Handeln notwendig. Im Gegensatz zu theoretischen Lernsituationen sollen alle Sinne angesprochen und somit nicht nur kognitive, sondern auch senso-motorische und affektive Ebenen des Lernens berücksichtigt werden. Im Sinne der Tradition Rousseaus und Pestalozzis geht es um Lernen durch Kopf, Herz und Hand. Der daraus hervorgehende Begriff der Ganzheitlichkeit „geht zudem davon aus, dass das Ganze mehr als die Summe seiner Teile ist, dass es also Phänomene gibt, die nicht als Folge eines Teilbereichs erklärbar sind“ (Heckmair/Michl 2002, 269).
2 Lernen in Situationen mit Ernstcharakter Eine besondere Bedeutung für das Setting erlebnispädagogischer Angebote kommt nach Ansicht Galuskes dem Ernstcharakter der Situation zu. Im Idealfall ergebe sich aus den jeweiligen Gegebenheiten ein Sachzwang, der scheinbar ohne das Eingreifen eines Pädagogen von außen, allein durch die Unmittelbarkeit der Situation, Lernprozesse in Gang setze. Anders als bei der Durchführung pädagogischer Aufgaben, Übungen und Spiele zeigt das Verhalten der Teilnehmer nicht nur in der Reaktion des Pädagogen, sondern (auch) unmittelbar in der Lebenssituation Auswirkungen. Dies wird „dort am ehesten erfahrbar, wo es um die Befriedigung elementarer Lebensbedürfnisse (Nahrung, Wasser, Schlaf, physische Sicherheit, Zugehörigkeit, Einflussmöglichkeiten) geht“ (Reiners nach Galuske 1999, 211). Der entscheidende Faktor ist hier offenbar, dass sich der Lerninhalt aus dem Kontext erklärt und nicht theoretisch vom Pädagogen vorgegeben wird. „Entgegen vielfältigen Formen institutionalisierter Wissensvermittlung (z.B. schulisches Lernen) steht nicht die Anhäufung von Wissen und das Vertrösten auf die Möglichkeit späterer Anwendung („Non vitae, sed scholae discimus“) im Mittelpunkt dieser pädagogischen Vorgehensweise, sondern die Vermittlung unmittelbar notwendiger und sinnfällig werdender Fähigkeiten und Fertigkeiten.“ (Berger/Frech in: http://www.sowi-online.de/methoden/dokumente/erlebnis_berger.htm )
Diese Maxime erinnert an Rousseaus Erziehungsroman „Emil“, in dem er dafür plädiert, ein Kind aus den Konsequenzen seiner Handlungen lernen zu lassen. Wenn z.B. ein zerbrochenes Fenster nicht repariert wird, wird die Handlung, die zum Zerbrechen der Scheibe führte, nicht indirekt durch den Erzieher, sondern direkt durch die Lebenssituation, hier die hereinkommende Kälte, sanktioniert. Allerdings manipuliert der Erzieher hier die Sachen so, dass sie für den Zögling als ein Lernarrangement mit klarer Ziel- und Erwartungsgerichtetheit gilt. Die darin subtil entwickelte autoritäre Unterwürfigkeit unter ein pädagogisches Modell muss als prinzipiell problematisch angesehen werden. Hans Peter Hoeg hat dies in seinem Roman „Der Plan von der Abschaffung des Dunkels“ in einem eindrucksvollen Erlebnisbericht ausgedrückt. Hier sollten alle Erlebnispädagogen eine durchgehend kritische Einstellung einnehmen, denn ihre Konstruktionen sollten auf einen Zugewinn an Partizipation und kritischer Reflexion, nicht aber auf indirekte Instruktionen von wohlmeinenden Pädagogen zielen. Auch Heckmair und Michl sprechen sich mit deutlichen Einschränkungen (insbesondere der Sicherheit) für das Prinzip „trial and error“ aus. Sie halten ein möglichst hohes Maß an Mitbestimmung für ein wesentliches Lernziel und stehen für Improvisation, Freiraum und Selbstregulation anstelle von pädagogischer Überbetreuung (vgl. Heckmair/Michl 2002, 201). Anders formuliert könnte es heißen: „Lasst die Teilnehmer aus ihren eigenen Fehlern lernen!“
3. Gruppe als Lerngemeinschaft Ein wichtiger Akzent der Erlebnispädagogik liegt auf dem Erlernen sozialer Kompetenzen und Kooperationsfähigkeit. Die meisten erlebnispädagogischen Angebote werden daher für Gruppen konzipiert. In der Gruppe werden wichtige Erfahrungen des Miteinanders gemacht. Anders als beispielsweise in der Schule erfordert die Unausweichlichkeit der Situation und das enge Zusammenleben über eine gewisse Zeit eine aktive Auseinandersetzung mit den anderen Teilnehmern. Konflikte müssen ausgetragen, bestimmte Regeln des Zusammenlebens eingehalten werden. Auch Stärken und Schwächen einzelner müssen Berücksichtigung finden. Prinzipien des Helfens, der Verantwortung und des Rücksichtnehmens werden erlernt. Gleichzeitig wird bei vielen gemeinsamen Aktivitäten festgestellt, dass nur gemeinsames Handeln und Kooperation zum gewünschten Erfolg führen. „Oftmals zeigt sich im Verlauf erlebnispädagogischer Aktivitäten, daß individuelle Leistungen und Erfolge wesentlich von der Gruppe abhängig sind“ (Berger/Frech in: http://www.sowi-online.de/methoden/dokumente/erlebnis_berger.htm). Da die deutsche Schule zu wenig Gruppenerfahrungen ermöglicht, da das dreigliedrige Schulsystem strukturell den konkurrenzorientierten Ego-Lerner fördert und zu wenig Solidarität im Sinne einer gegenseitigen Hilfe und Entwicklung in leistungsheterogenen Gruppen organisiert, sind erlebnispädagogische Angebote ein besonders wichtiger Ausgleich.
4. Erlebnischarakter „Lernen durch Erleben ist in außereuropäischen Gesellschaften ein unumstrittenes und letztlich sehr erfolgreiches Prinzip“ (Heckmair/Michl 2002, 270). Auch die Erlebnispädagogik macht sich dieses pädagogische Axiom, eines Lernens durch Erleben, zunutze. Sie setzt auf die prägende Wirkung von Erlebnissen und geht davon aus, dass so Erlerntes länger in Erinnerung bleibt. Nach Galuske erhöht sich die Chance, dass aus bloßen Ereignissen prägende und nachhaltig wirkende Erlebnisse werden, wenn „die Lernsituationen einen außergewöhnlichen Charakter besitzen ... und Grenzerfahrungen ermöglichen“ (Galuske 1999, 211). Daraus erklärt sich für ihn die Notwendigkeit einer Alltagsdistanz erlebnispädagogischer Angebote. Dieses Merkmal unterscheidet die Erlebnispädagogik von anderen handlungsorientierten Maßnahmen, die in der Gruppe stattfinden und einen Ernstcharakter besitzen. Galuske nennt hier das Beispiel einer gemeinsamen Renovierung der Gruppenräume durch eine Jugendwohngemeinschaft. Dieses Projekt ist zwar handlungsorientiert, wird in der Gruppe durchgeführt und kann auch einen Ernstcharakter nicht verleugnen, der (für Galuske) entscheidende Faktor der Außergewöhnlichkeit ist jedoch nicht gegeben. Zwar ist es nach unserer Einschätzung durchaus möglich, dass ein solches Projekt einen ebenso großen Erlebniswert haben kann wie alltagsfernere Aktionen, dennoch möchten wir Galuske insofern zustimmen, dass Lernprozesse und Änderungen des Verhaltens wohl leichter mit Abstand zum alltäglichen Umfeld und zu bereits eingefahrenen Strukturen möglich sind. Dies hängt damit zusammen, dass hier Imaginationen und Visionen einfacher freigesetzt werden können. Allerdings würden wir auch für eine Erlebnispädagogik im Kleinen plädieren, denn ein Erleben, das Perspektiven verstört und neue entwickelt, muss nicht immer an große Ereignisse gebunden sein. Vor allem wenn die Beziehungen in den Erlebnissen positiv entwickelt werden, kann es auch im Kleinen zu großen Veränderungen kommen.
5. Pädagogisches Arrangement Wenn einerseits insbesondere das Erschaffen von Situationen mit besonderem Erlebnischarakter die Erlebnispädagogik von anderen pädagogischen Methoden trennt, so unterscheidet sie sich andererseits von weiteren erlebnisträchtigen Angeboten (Outdoor-Trainings usw.) erst und gerade durch ihren pädagogischen Anspruch. Zu einem erlebnispädagogischen Arrangement gehört „einerseits die gezielte und absichtsvolle Planung und Realisierung von Angeboten, andererseits aber auch die Beteiligung von erlebnispädagogisch geschultem Personal“ (Galuske 1999, 211). Berger und Frech betonen die „Wechselwirkung von Aktion und Reflexion“ als besonderes Kennzeichen der Erlebnispädagogik. „Das platte und oftmals nur Aktionismus auslösende Motto »Der Weg ist das Ziel!« wird zur unter Umständen gewichtigeren Direktive »Der Umweg ist auch ein Weg! « umformuliert ... Die Orientierung an der Aktion benötigt das komplementäre Element der Reflexion, damit erlebnispädagogische Ansätze nicht Gefahr laufen, zum »blinden Aktionismus«“ zu verkommen“ (Berger/Frech in: http://www.sowi-online.de/methoden/dokumente/erlebnis_berger.htm ).
4.2 Warum Erlebnispädagogik?Die Erlebnispädagogik nimmt grundsätzlich die prägende Wirkung von Erlebnissen als positiv an. Doch mit welcher Zielsetzung? Welche pädagogischen Ziele sollen hierbei erreicht oder angesteuert werden? Und wie sehen ihre Zielgruppen aus? Erst wenn die Erlebnispädagogik in erzieherischer Absicht eingesetzt, geplant und vollzogen wird, scheint sie sich überhaupt in das Konstrukt Erlebnispädagogik zu verwandeln. Um Erlebnispädagogik als pädagogische Methode zu beschreiben, ist es daher hilfreich, auf diese erzieherische Absicht oder die Zielsetzung etwas genauer einzugehen. Mehrere Dimensionen von Lernzielen in der Erlebnispädagogik können wir finden: Neben dem fachlichen Bildungsanspruch werden sachliche, individuelle, soziale und ökologische Lernziele oft genannt. In der Praxis werden diese Aspekt stets vernetzt betrachtet werden müssen: „Fachliche Lernziele beziehen sich direkt auf den Erwerb von fachlichen Kompetenzen, z.B. Techniken in (Extrem-)Sportarten, Segeln usw. Auf das Subjekt bezogene Lernziele stehen im Zentrum der Erlebnispädagogik. Dazu gehören u.a. Selbstständigkeit und Entscheidungsfähigkeit erlangen, eigene Grenzen und Ressourcen entdecken und fördern bzw. abbauen, Gefühle wahrnehmen, sie ausdrücken und mit ihnen umgehen lernen, Selbstbewusstsein steigern, Ausdauer, Durchhaltewille und Kontinuität üben usw. Die sozialen Lerndimensionen thematisieren alle Fähigkeiten der TeilnehmerIn, sich in Gruppenzusammenhänge zu integrieren, wie z.B. Rollenverhalten wahrnehmen und einüben, kooperatives Handeln trainieren usw. Die ökologische Lernzieldimension hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Hier geht es z.B. um die sinnliche Wahrnehmung und Entdeckung ökologischer Zusammenhänge, der Einübung umweltschonenden Verhaltens“ (Galuske 1999, 212). Galuske hebt besonders die Relevanz der individuellen Lernziele hervor. Weiter räumt er ein, dass ökologische Ziele zukünftig verstärkt in die erlebnispädagogische Diskussion rücken sollten. Eine sehr große Bedeutung sollte – nach unserer Einschätzung – den sozialen Lernzielen zukommen, da diese für den deutschen Schulalltag besonders verkümmert scheinen. Da die deutsche Schule zu wenig ein Verständnis im Sinne einer community entwickelt hat, was durch die Dreigliedrigkeit des Schulsystems auch strukturell verschärft wird, sollte gerade der soziale Bereich in außerschulischen Maßnahmen besonders stark ausfallen. Hier wird in Deutschland zu sehr Egoismus und Konkurrenz statt community und Solidarität gefördert. Daher ist gerade das sozial-therapeutische Potenzial der Erlebnispädagogik eine wichtige Gegenkraft, die in Zukunft wieder stärker Beachtung finden sollte. Allerdings ist das Soziale immer mit dem Individuellen zu verknüpfen: Grundvoraussetzung für ein solidarisches soziales Verhalten bleibt ein hoher Selbstwert, d.h. die Anerkennung und Förderung individueller Stärken wie Selbstvertrauen und Akzeptanz der eigenen Person. Auf solcher Basis kann dann auch ein Perspektivwechsel in andere Erlebensbereiche und Handlungsfelder erfolgen. Eine weitere Klassifizierung von Zielen übernehmen Heckmair/Michl von Priest, der affektive Ziele („change the way people feel“), kognitive Ziele („change the way people think“), verhaltensbezogene Ziele („change the way people behave“) und therapeutische Ziele („change the way people misbehave“) unterscheidet. Diese vier Zielbeschreibungen dienen Priest zur Klassifizierung von vier Programmtypen der Erlebnispädagogik, die sich in der jeweiligen Akzentsetzung unterscheiden. Heckmair/Michl betonen, dass dies keine Zerstückelung des ganzheitlichen Erfahrungs- und Lernverständnisses handlungsorientierter Erziehung sein soll, sondern lediglich eine Hilfestellung, „um Konzepte mit definierten Zielrichtungen besser fassen und einordnen zu können“ (Heckmair/Michl 2002, 92). Sie sprechen sich für diese Klassifizierung aus, da sie ein großes Spektrum handlungsorientierter pädagogischer Praxis –unterschiedlicher Dimensionen, Intentionen und Zielgruppen – umfasst. In diese Programmtypen lassen sich auch die vier von Galuske genannten Dimensionen von Lernzielen eingliedern. Beispielsweise kann ein Programm mit der „Zielrichtung“ Verhaltensänderung sowohl Verhaltsänderungen im sozialen Umgang anstreben, als auch im Umgang mit sich selbst oder im Umgang mit der Natur. Ein klarer Schwerpunkt dieser Klassifizierung scheint jedoch ebenfalls auf den individuellen Lernzielen zu liegen. Auch hier erscheinen wieder insbesondere die sozialen Defizite in der Ausrichtung dieser Erlebnispädagogik. Ein gemeinsames Erleben, wie es z.B. sinngebend im Film Der Club der toten Dichter viele beeindruckte, ist in Deutschland ein derzeit eher vernachlässigtes Thema. Denken wir an soziale Erlebnisse, dann haben viele Pädagogen eine Scheu davor, ihre Teilnehmer in eine bestimmte Richtung zu drängen. Insoweit wird öfter bereits der instrumentelle Charakter von Zielen beklagt. Auf die Kritik, dass der „Ziel“-Begriff die Teilnehmer unkritisch in eine Objektrolle dränge, reagieren Heckmair/Michl mit dem Vorschlag, den Begriff der Zielsetzung durch Zielrichtung oder noch offener Entwicklungsthema zu ersetzen. Dabei orientieren sie sich am Werte- bzw. Entwicklungsquadrat von Schulz von Thun, wonach es für jeden positiven Wert sowohl einen positiven Gegenwert als auch einen negativen Unwert gibt. Die Übertreibung eines Wertes führt jeweils zum negativen Unwert. „Nehmen wir beispielsweise den Wert »Vertrauen«. Der positive Gegensatz dazu wäre »Vorsicht«, entwertende Übertreibungen wären die »naive Vertrauensseligkeit« (bezogen auf »Vertrauen«) und das »paranoide Misstrauen« (bezogen auf »Vorsicht«)“ (Heckmair/Michl 2002, 93). Als Konsequenz für die Erlebnispädagogik sehen sie die Notwendigkeit einer Neu-Formulierung der Zielsetzungen. Anstelle eindimensional definierter Ziele solle eine offene Entwicklungsrichtung stehen, die nicht den Auf- oder Abbau eines Wertes zum Ziel hat (z.B. Aufbau von Vertrauen/Abbau von Ängsten), sondern eine Balance von zwei gegensätzlichen Werten (z.B. »Vertrauen« und »Vorsicht«) anstrebt, so dass weder der eine noch der andere in den negativen Unwert kippt (vgl. Heckmair/Michl 2002, 93f.). Diese Scheu erscheint uns als übertrieben, wenn das pädagogische Verhältnis grundsätzlich partizipativ ausgerichtet wird, wie es die konstruktivistische Pädagogik fordert. Ziele können immer zu einseitigen Konstruktionen werden, und mitunter hat dies auch den Sinn einer Entscheidungsfindung, nachdem man das Für und Wider abgewogen hat. Die Instrumentalisierung beginnt für uns dann, wenn solche Ziele verschwiegen, manipuliert eingesetzt, subtil unterstellt werden, statt als viable Konstrukte offen gelegt und diskutiert zu werden. Auch hier erweist sich eine soziale und dabei demokratische Grundorientierung als notwendig, eine Begründung aus einem Erleben an sich oder einer als reine Natur aufgefassten natürlichen Erlebenswelt hingegen ist irreführend. Wie eindimensional Erlebnispädagogen oft ihre Zielgruppen definieren, ist zu erkennen, wenn sie ausschließlich aus betreuten Gruppen, d.h. ihrer gegenwärtigen Praxis denken. So nennt Hufenus „Schüler, Familien, Frauengruppen, Mitarbeiter von Institutionen, Manager, religiöse Gruppierungen, alte Menschen, Problemjugendliche, Drogenabhängige, Alkoholiker, Invaliden, Arbeitslose, psychisch Kranke, chronisch bzw. unheilbar Kranke, straffällige Erwachsene, sexuell Missbrauchte“ (Hufenus zitiert nach Galuske 1999, 212) als relevante Zielgruppen. Die Einsatzfelder sind dementsprechend vielfältig, aber zugleich unzureichend auf Zielgruppen beschränkt. Wir hingegen meinen, dass der Anspruch von Erlebnispädagogik zunächst nicht zielgruppenspezifisch sein sollte, sondern sich in allen Bereichen unserer Gesellschaft zu stellen hat. Dies gilt sowohl in Hinsicht auf die Einführung von praktischen Erfahrungen, aber auch in kritischer Hinsicht im Blick auf eine grundsätzliche Reflexion der so genannten Erlebnisgesellschaft. Wir verkennen nicht, dass insbesondere für die soziale Arbeit die Erlebnispädagogik in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Dies gilt sowohl in der Jugendarbeit als auch im Bereich der erzieherischen Hilfen und in anderen Arbeitsfeldern mit benachteiligten Jugendlichen und Randgruppen. Es wäre aber wichtig, den Horizont zu erweitern und insbesondere auch die Schulen verstärkt einzubeziehen. Sofern wir uns hierbei auf eine bestehende Zielgruppenarbeit beschränken, verkennen wir das Potenzial der Erlebnispädagogik. Auch wenn sich vor 100 Jahren die Erlebnispädagogik in ihren Anfängen überwiegend auf den schulischen Bereich konzentrierte, so liegt ihr derzeitiger Schwerpunkt auf außerschulischen Angebotsformen (u.a. private Anbieter, soziale Einrichtungen, Vereine). Dennoch bleibt auch die Schule ein mögliches Einsatzfeld, das es zu nutzen gilt. Ein Blick in die Fachliteratur verleitet Heckmair/Michl zu der Vermutung, dass die Erlebnispädagogik „auf dem besten Weg zurück in die Schule“ (2002, 151) sei. Als Möglichkeit, erlebnispädagogische Elemente in die Schule zu integrieren, nennen sie aber dann doch nur sehr einschränkend den Schulsport. Dazu zitieren sie Wolfram Schleske, der bereits 1977 „vielfältige kindgemäße Risikosituationen der exponierten Raumerfahrung und der ungewöhnlichen Lokomotion, des spielerischen und explorativen Umgangs mit Medien, Geräten und Partnern und allerlei wagemutige Unternehmungen in der freien Natur“ forderte. Heckmair/Michl (2002, 151 ff.) haben ausgehend von dieser Forderung einige Umsetzungsmöglichkeiten angedacht: Beispielsweise könne mit Hilfe von Tauen, Schaukeln und Kletterwänden in Turnhallen die dritte Dimension wieder entdeckt werden. Mit Rollbrettern, Wippen, Schwebebalken oder anderen Hilfsmitteln werden ungewohnte Bewegungsformen erfahrbar. Abenteuerarrangements im nah gelegenen Wald oder auf dem Sportplatz sowie Laufprojekte und Initiativspiele seien Möglichkeiten, um auch im schulischen Alltag erlebnispädagogische Elemente zu integrieren. Dies gelte nicht nur für den Sportunterricht. Anstelle des Klassenzimmers können Wald, Höhle, Meer oder Berggipfel als geeignete Orte für Gedichtvorträge entdeckt werden. Auch mit dem Fahrrad den Spuren der Geschichte zu folgen, sei eine denkbare Möglichkeit. Biologieunterricht werde zum Erlebnis, wenn der Wald der Lehrmeister sei. Uns fehlt hier eine Erlebnispädagogik im Kleinen, die einen fantasievollen Lehrer erfordert, um im Unscheinbaren das Erleben aufscheinen zu lassen, das in allen menschlichen Begegnungen und Vermittlungen mit Konstruktionen von Wirklichkeiten aufscheinen kann. John Dewey sah hierbei vor allem eine grundlegende experimentelle Einstellung (auch in den geisteswissenschaftlichen Fächern) als einen hilfreichen Weg an, um Kognitionen und Erleben zusammenbringen zu können. Heckmair/Michl verstehen die Erlebnispädagogik nicht als Allheilmittel gegen die Verhärtungen schulischen Lebens, sehen in ihr aber die Chance, „Impulse, Abwechslung, Anstöße und Aufbrüche in die Routine des Alltags (zu) bringen“ (ebd., 150). Nach Reich ist dies insbesondere auch in der konstruktivistischen Didaktik gefordert. In ihr sollen die vielen Konventionen und Diskurse, die wir in der Bildung einnehmen und führen, immer auch zurück in sinnliche Gewissheiten, in Situationen und Erlebnisse gebracht werden, um den Lernern eine Viabilitätsprüfung zu erlauben (vgl. dazu Reich: Konstruktivistische Didaktik)..
4.3 Wie wirkt Erlebnispädagogik? Die Erlebnispädagogik macht sich die prägende Wirkung des besonderen Erlebnisses zu eigen. Grundlage hierzu ist es, Lernerfahrungen zu machen und zu verinnerlichen. Je länger diese Lernerfahrungen nachwirken und je erfolgreicher sie in Alltagssituationen übertragen werden können, desto größer scheint der Lernerfolg zu sein. Bei der Beschreibung der Merkmale von Erlebnispädagogik haben wir gesehen, dass eine gewisse Alltagsdistanz dabei helfen kann, aus Ereignissen prägende und nachwirkende Erlebnisse werden zu lassen. Doch welcher Medien bedient man sich, um diese besonderen Erlebnisse zu ermöglichen? Und wirken diese Erlebnisse einfach für sich oder bedarf es des Eingreifens von Pädagogen, um Lernziele, Alltagsbezug und Transfermöglichkeiten aufzuzeigen? Inwiefern haben Pädagogen überhaupt die Möglichkeit, Lernziele zu bestimmen? Wirkt nicht jedes Erlebnis auf jeden Menschen anders? Ist Einflussnahme überhaupt möglich und sinnvoll, oder kann es lediglich Ziel der Erlebnispädagogik sein, Anstöße zu geben? In diesem Abschnitt sollen verschiedene Medien der Erlebnispädagogik genannt werden, um anschließend drei unterschiedliche Lernmodelle vorzustellen, wie die Erlebnisse in den Alltag übertragen werden können. Abschließend soll ein Blick in die konstruktivistische Sichtweise von Erlebnispädagogik getan werden, die die Möglichkeit einer zielgerichteten Einflussnahme durch Pädagogen, wenn nicht überhaupt in Frage stellt, dann doch zumindest relativiert. Die Erlebnispädagogik bedient sich verschiedener klassischer Medien, die zum Großteil natursportlicher Natur sind. Dazu gehören z.B.: Klettern/Abseilen; Höhlenbegehungen; (Berg-)Wandern; Skitouren; Kanu/Kajak; Schlauchbootfahrten/Rafting; Fahrradtouren ; Segeln; Hochseilgarten/ Initiativübungen; Solo; City Bound. Eine detaillierte Beschreibung dieser Aktivitäten einschließlich eines tabellarischen Vergleichs findet sich bei Heckmair/Michl (2002, 161-207). Die natursportliche Prägung ist bei fast allen Aktivitäten gegeben. Nur City Bound, dessen Konzept darauf ausgerichtet ist, außergewöhnliche Erlebnisse in der Stadt zu ermöglichen, und Hochseilgarten und Initiativübungen, die auch im städtischen Rahmen denkbar sind, weichen bisher von diesem Prinzip ab. Bei dieser Liste können wir allerdings die Outdoor-Lastigkeit solcher Erlebnispädagogik bemängeln. Erlebnisse reduzieren sich hier zu sehr auf Sporterlebnisse. Dagegen sollte sich die Erlebnispädagogik auf einen Erlebensbegriff besinnen, wie er von Howard Gardner in seinen „multiplen Intelligenzen“ als eine Möglichkeit vieler anderer Fähigkeiten entwickelt wird. Erlebnisse gibt es auch im Theaterspiel, in der Ästhetik, Rhetorik, Musik, bei Spielen usw. Vgl. dazu http://www.education-world.com/a_curr/curr054.shtml. Weiterführende Literatur auch unter gardner.pdf. Einen weiteren Kritikpunkt sehen wir in der oft zu großen Trennung von Alltag und Erlebnis. So wird die Alltagsdistanz vielfach als notwendig empfunden, um Erlebnisse zu ermöglichen, gleichzeitig ist sie auch der Grund dafür, weshalb Erlebnispädagogik zu einer „Inselpädagogik“ verkommen kann, die keinen nachweislichen Bezug zum Alltag hat und in Problemsituationen des Alltags nicht weiter hilft. Berger/Frech sehen hier die Gretchenfrage der Erlebnispädagogik. Einen möglichen entschuldigenden Bezug auf eine erwartete Langfristigkeit der Wirkung finden sie zwar verständlich, sie weisen aber darauf hin, dass diese ebenso für andere kurzzeitpädagogische Maßnahmen im Rahmen politischer oder ökologischer Bildung gelten könnte. (Berger/Frech in: http://www.sowi-online.de/methoden/dokumente/erlebnis_berger.htm). Wir können solche kritischen Fragen allerdings nicht allgemein beantworten, sondern müssen sie von Fall zu Fall entscheiden. Erlebnispädagogik sollte zudem nicht verabsolutiert werden. Auch Heckmair/Michl sprechen sich dafür aus, Erlebnispädagogik als eine von vielen pädagogischen Methoden zu sehen und sie nicht anstelle von, sondern in Kombination mit anderen, alltagsbegleitenden Maßnahmen anzuwenden. Zudem hängt die Transferchance ganz erheblich davon ab, inwiefern es gelingen kann, die Erlebnisse zu Lernerfahrungen zu verarbeiten. Anhand von Modellen sollen verschiedene methodische Ansätze vorgestellt werden, die sich insbesondere darin unterscheiden, inwiefern der Pädagoge in den erlebnisorientierten Lernprozess eingreift. Bei Heckmair/Michl findet sich zum einen das Phasenmodell von Bacon (Bacon 1983, zitiert nach Heckmair/Michl 2002, 54 ff.), das von einer grundsätzlichen Entwicklung der Erlebnispädagogik ausgeht:
Von diesen 3 Modellen ausgehend entwickelt Priest (1994, zitiert nach Heckmair/Michl 2002, 94 ff.) eine weitere Differenzierung, die sich auch heute in erlebnispädagogischen Programmen wiederfindet. Er unterscheidet 6 Modelle, die sich in zwei große Blöcke fassen lassen: Der erste Block umfasst methodische Ansätze, die Verhaltensänderungen nach den Aktivitäten anstreben:
Der zweite Block besteht aus Ansätzen, die bereits vor, während und durch die Lernsituation wirken sollen:
Heckmair/Michl (2002, 96) beklagen den mechanischen Duktus dieser amerikanischen Theoriebildung, wollen Priests Modell aber als Chance begreifen, die Konfusion um den „immer noch schicken Erlebnisbegriff“ (ebd., 97) zu vermindern, ohne einzelne Ansätze vorschnell auszugrenzen. Bleiben wir bei der Kategorisierung der Programmtypen nach Priest, so fällt dem jeweiligen Pädagogen (je nach Modell) eine sehr unterschiedliche Rolle zu. Je nachdem, von welchem Ansatz er ausgeht, lässt er die Aktion für sich selbst wirken, resümiert oder reflektiert er im Nachhinein, zeigt er Bezüge und Übertragungsmöglichkeiten schon vor und während der Aktion auf oder konstruiert selbst eine Situation, die (metaphorisch) Parallelen zum Alltag aufzeigt. Diese letztgenannte Möglichkeit erinnert bereits an eine konstruktivistische Sichtweise, die jede Wirklichkeit als eine Konstruktion des jeweiligen Beobachters begreift, die sich von der Wirklichkeit des nächsten unterscheidet. Folgt man diesem Ansatz, stellt sich grundsätzlich die Frage nach der Rolle des Pädagogen: Welche Möglichkeiten der Einflussnahme bleiben, wenn die Wirklichkeiten der Teilnehmer sich von der meinen grundsätzlich unterscheiden? Heckmair/Michl (2002, 62) formulieren es so: „Die Bilder, die sich ein Mensch von seiner Mitwelt macht, sind – so die Konstruktivisten – Produkte eines autonomen Systems, das prinzipiell nicht zugänglich ist. Lernen ist im Anschluss daran die Selbstregulation dieses Systems, was Fritz B. Simon wohl zum Bonmot getrieben hat, Regieren, Kurieren und Erziehen zu »unmöglichen Berufen« zu erklären. Dies hilft uns an dieser Stelle auch nicht wirklich weiter, eröffnet indessen ernüchternde Einsichten in die Beschränktheit unseres Tuns. Und das ist gut so!“ In diesen Aussagen referieren die Autoren allerdings nur die Position des radikalen Konstruktivismus, die einseitig subjektivistisch orientiert ist. Mittlerweile gehen die meisten Konstruktivisten von einer kulturalistisch geprägten Konstruktion aus, die uns doch weiter helfen kann, indem wir einerseits unterschiedliche Versionen von Wirklichkeit zugestehen können und müssen, andererseits aber mit den Teilnehmern auch auszuhandeln haben, welche viable Konstruktion wir in unseren Erlebenszusammenhängen verwenden wollen. Folgt man dieser Sichtweise, relativiert sich zwar die Möglichkeit der zielgerichteten Einflussnahme mit Hilfe erlebnispädagogischer Programme im Sinne eines einfachen Instruktionsprozesses, doch gleichzeitig werden Chancen einer gemeinsamen Konstruktion im Prozess des Erlebens und seiner Verarbeitung möglich. Die Erlebnispädagogik wird dabei als eine wichtige Möglichkeit gesehen, relevante Anstöße und Anregungen zu geben. Dabei erwarten wir allerdings grundsätzlich nicht, dass alle Menschen eine Situation gleich erleben können oder werden. Ein Beispiel erlebnispädagogischer Aktivitäten nach konstruktivistischer Sichtweise bieten die Jugendfahrten der Berliner Gruppe „Story Dealer“ Wir sehen hierin ebenfalls gelungene Beispiele konstruktivistisch orientierter Erlebnispädagogik. Wir kritisieren jedoch prinzipiell, dass außer den Betreuern alle anderen Beteiligten auch nach dem Prozess nicht in die Manipulationen eingeweiht werden, die zu den Erlebnissen und ihre Verarbeitung führen. Hier sehen wir eine Unmündigkeit, die mit dem partizipativen Anspruch konstruktivistischer Pädagogik unvereinbar ist und die uns einen nicht vertretbaren Machtanspruch darzustellen scheint. Wir vertrauen hingegen für alle Gruppen und Altersstufen darauf, dass Lerner aus einer jeweiligen Beobachterperspektive aussteigen können, ohne dass dieser Perspektivwechsel ihnen die Freude am Erleben nehmen muss. Gerade in einer immer mehr auf Simulation aufbauenden Welt halten wir es für sehr gefährlich, wenn wir diese Chance der Reflexion im bloßen Wunsch nach gelungenen Inszenierungen verspielen (vgl. dazu auch Reich/Sehnbruch/Wild: Konstruktivismus und Medien – eine Einführung in die Simulation als Kommunikation. Münster (Waxmann) 2004). |