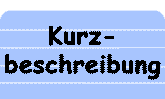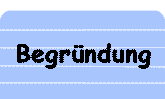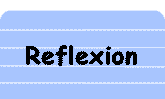|
4. Darstellung
der Methode
In den meisten deutschen Schulen wird bis heute den Lernern nicht genügend Entfaltungsraum für Selbsttätigkeit, Mitbestimmung und Mitgestaltung gegeben. Die dafür angeführten Gründe beziehen sich unter anderem oft auf strukturelle Probleme wie Zeitmangel, zu große Gruppen, zu viel Stoff usw. Also Rahmenbedingungen, durch die dem Lehrenden in seinem didaktisch-methodischem Handeln Grenzen gesetzt werden. Doch neben dieser äußeren Begrenzung, die einen Methodeneinsatz, der einen größeren Gestaltungsspielraum für die Schüler zulässt, behindert, sollte sich vorrangig immer der Lehrende selbst als Ursache für die geringe Selbst- und Mitbestimmung sowie konsequente Selbsttätigkeit der Lernenden in Unterricht und Schule sehen. Letztlich eröffnen sich durch Engagement auch trotz der strukturellen Hindernisse Möglichkeiten und Wege, im Unterricht „Demokratie im Kleinen“ zu praktizieren. Ein Grund mag in der eigenen „pädagogischen Biografie“ der Lehrenden wurzeln: Pädagogen fühlen sich oft nicht in der Lage, den Schülern einen Lernprozess zu ermöglichen, in dem sie eigenverantwortlich und selbsttätig handelnd eingebunden sind, da ihnen selbst die Erfahrung einer hinreichenden Selbsttätigkeit in ihrer Ausbildung fehlte.
Vor dem Hintergrund solcher Problematik vertrauen Pädagogen immer noch „auf Einsicht nach einem allgemeinen Aneignungskonzept: die Teilnehmer werden schon verstehen, dass man nicht alles tun kann. Sie werden trotzdem akzeptieren, dass die Sachverhalte richtig sind. In dieser beschränkten Aneignung sind sie minimal durchaus ja auch selbsttätig. Indem sie verstehen, dass sie nicht umfassend selbsttätig werden können, lernen sie die arbeitsteilige Welt verstehen.“ (Reich: Konstruktivistische Didaktik, 64)
Aus interaktionistisch-konstruktivistischer Perspektive wird dazu eine gegenteilige Position eingenommen. Solange der Lernende nicht so umfassend wie möglich den Lernprozess durch selbsttätiges Handeln (mit-)bestimmt, Wissen nicht eigenständig und selbstbestimmt erarbeitet wird und dabei keinen Bezug zur Lebenswelt des Lernenden ausdrückt und findet, solange wird angeeignetes Wissen, konstruktivistisch gesehen, in der Regel zu oberflächlich und aufgesetzt bleiben. Gelerntes wird schnell vergessen, da es wenig Bezug zum Sinn- und Problemhorizont des Lerners und zu seinem alltäglichen Leben hat. Das Interesse, „Dingen auf den Grund zu gehen“, die Kompetenz, verschiedene Beobachterperspektiven einnehmen zu können, und die Neigung, Themen, die der eigenen Neugier entspringen, mit in den Unterricht einzubringen, wird durch fremdbestimmtes Lernen behindert. So scheint Schule oftmals lediglich ein Ort der Reproduktion leeren und toten Wissens, da Lerner Inhalte rekonstruieren müssen, ohne diese mit den eigenen Erfahrungen und Interessen verknüpfen zu können. Ohne die Möglichkeit, den Lernprozess anhand solcher Verknüpfungen aktiv mitzugestalten, werden Lerner nur gering befähigt, eigene Entscheidungskompetenzen und selbsttätige Handlungs- bzw. Lerninitiative zu entwickeln.
Die Grundlage jeglicher Form von Selbstbestimmung der Lerner liegt in ihrer Möglichkeit zur Mitbestimmung und zum selbsttätigen Handeln. Je umfassender die Lernenden mitbestimmen können, was für sie lernrelevant ist, desto selbstbestimmter können sie den Lernprozess gestalten. Je größer der Möglichkeitsraum der Selbsttätigkeit ist, umso selbstständiger, freier und ggf. anspruchsvoller kann sich die Gestaltung eines solchen Lernprozesses entwickeln. Auf diese Weise wirken im Kontext des schulischen Geschehens oder in anderen pädagogischen Kontexten Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Selbsttätigkeit aufeinander ein, bedingen sich gegenseitig und bilden so eine untrennbare Triade. Denn ebenso wie Selbsttätigkeit die Basis für die gelungene Gestaltung selbstbestimmter Prozesse markiert, dient auch die Möglichkeit, selbstbestimmt zu lernen, als motivierende Grundlage, selbsttätig zu werden, also durch eigenständige Arbeit einen fruchtbaren Lernprozess voranzutreiben.
Selbstbestimmung im Lernen schafft erst die Voraussetzung, Sachverhalte und Inhalte länger zu behalten, da dem Lernenden selbst die Relevanz und der Sinn des Lernvorgangs und Lerninhalts bewusst ist und er über Anknüpfungspunkte verfügt, die seine Lebenswirklichkeit mit dem Lernstoff verbinden – und sei es „nur“ ein abstraktes Interesse an einem Thema. Zudem fördert die Möglichkeit der Selbstbestimmung durch den Freiraum, den sie impliziert, die Bereitschaft, sich mit Dingen aus verschiedenen Perspektiven auseinander zu setzen. Eine solche Bereitschaft wiederum erscheint notwendig für jeden demokratischen Vorgang, also auch für jenen der Mitbestimmung in pädagogischen Feldern.
Im Rahmen des Schullebens oder in pädagogischen Prozessen allgemein ist keine absolute Selbstbestimmung etwa im Sinne herrschaftsfreier Ideale möglich, weil dies schnell an die Grenzen der anderen in solchen Prozessen stößt – das Ziel ist jedoch eine möglichst umfassende altersgemäße Selbstbestimmung der Lerner. Dieses demokratische Grundanliegen drückt sich nicht in der Forderung nach einem großen demokratischen „Metaplan“ aus, dem Schule oder andere pädagogische Prozesse unterworfen werden müssen, sondern es beginnt immer im Kleinen.
Was heißt das konkret? Zunächst muss ein Bewusstsein dafür vorhanden sein, dass Lerner und Lehrende nicht wie gewohnt zwei (oft auch gegeneinander arbeitende) Parteien bilden, deren Aufgabenbereich klar voneinander getrennt ist – die Lehrenden planen und strukturieren in alleiniger Verantwortung den Lernprozess und setzen die Lernziele fest, die Lernenden folgen dieser Strukturierung und sollen die Lernziele erreichen, sofern sie versetzt oder belohnt werden wollen –, sondern dass beide gemeinsam dafür verantwortlich sind, das Schuljahr oder den pädagogischen Prozess erfolgreich zu gestalten. Im Laufe der Einlösung dieser gemeinsamen Zielsetzung können sie sich gegenseitig behindern oder vorwärts bringen. Eine gegenseitige Behinderung wurzelt etwa in einer Rollenverteilung, in der der Lehrende durchgängig eine dominant bestimmende Funktion übernimmt – dies widerspricht dem Anspruch der gemeinsamen Verantwortung und führt zu einem Verhalten der Lerner, das zwischen den Polen einer völligen Unterordnung, die allerdings den Preis der Verantwortungsabgabe hat, und eines rebellischen Verhaltens als offensichtlichen Ausdruck des Gegeneinanders oft verortet werden kann. Der mögliche Erfolg einer gemeinsamen Zielsetzung und Zusammenarbeit hängt wesentlich davon ab, wie offen und wertschätzend Lerner und Lehrende ihre Beziehungen gestalten.
Die Aufgabe, die sich in dieser Hinsicht den Lehrenden stellt, wird durch ein neues Rollenverständnis, einen neuen „Blick“ auf die Lerner und sich selbst erfüllt, sie besteht darin, zu lernen, alle Lerner als Partner wahrzunehmen – und zwar mit all ihren Interessen, Rechten und auch Pflichten. Die Basis für eine solche Beziehungsgestaltung sind klare Achtungsregeln, die gemeinsam mit den Lernern entwickelt werden. Dabei kommt der Achtung und Anerkennung jedes Einzelnen eine ganz besondere Bedeutung zu. Hierbei nimmt der Umgang mit Fehlern einen großen Raum ein, da besonders in diesem Bereich Entwertungen wirksam werden können, die zu Störungen auf der Beziehungsebene – namentlich Ausgrenzungen führen. Daher gilt es für die Lehrenden darauf zu achten, dass Fehler, die Lernende machen, von ihm nicht als negativ vor der Gruppe dargestellt werden. Lernende und Lehrende sollten Fehlern und Unsicherheiten mit dem Bewusstsein begegnen, dass diese zu jedem Lernprozess dazu gehören. Fehler sind an sich nicht problematisch für Lernprozesse, zum Problem kann hingegen der Umgang mit ihnen werden. Oftmals werden Lerner für „begangene“ Fehler von Lehrenden abqualifiziert. Diese meist öffentliche Entwertung scheint sich dann nicht nur auf den Fehler zu beziehen, sondern auf die ganze Persönlichkeit des Lerners. Wenn wir auf unsere eigene Schulbiografie zurückblicken, so fallen uns bestimmt mehrere Lehrer ein, die eine solche Abqualifizierung gezielt, fast schon methodisch einsetzten. Oberflächlich betrachtet scheint sie auch einige Vorteile zu bieten: Oft bringen solche Abwertungen, gerade wenn sie sarkastisch vorgebracht werden, einen Lacherfolg seitens der anderen Schüler mit sich, teils als Folge der Erleichterung, dass sie selber nicht „drangekommen“ sind, teils als Ausdruck des befriedigenden Gefühls, selbst niemals solch einen dummen Fehler machen zu würden, also klüger, schlauer, besser zu sein. So wird ein Gefälle innerhalb der Klasse aufgebaut, vor dessen Hintergrund Entwertungen die Schüler wohl motivieren sollen, die eigene Leistung zu verbessern, um nicht selbst abzufallen bzw. in der „Klassenhierarchie“ abzusteigen. Hier wird Leistung durch Konkurrenz nicht spielerisch erreicht, sondern durch den Motor der Angst unter dem Vorzeichen der Entsolidarisierung angetrieben. Vielleicht mag diese Methode auch Erfolge erzielen – im reproduktiven Bereich etwa, wahrscheinlich muss sich der Lehrende auch nicht sorgfältig mit dem einzelnen Schüler auseinandersetzen und kann widerstandslos seine dominante und machtvolle Stellung im Klassengefüge beibehalten bzw. eigene Schwächen und Unsicherheiten verdecken. Doch Solidarität, demokratisches Verständnis und Handeln sowie Förderung und Wahrnehmung der Kompetenzen des Einzelnen können auf diesem Wege nicht erfahren und gelernt werden. Ebenso wird ein eigenständiges, selbstbestimmtes und grundlegend positiv besetztes Lernen verhindert. Durch die Entwertung entwickelt der Schüler leicht das Gefühl, minderwertig zu sein, und verliert in solchen Situationen das Vertrauen zu sich selbst, seinen eigenen Erfahrungen (etwa im Lernprozess) und der Bedeutsamkeit seiner Beiträge für den Unterricht.
Meist ist dies das Ende eines von Neugier getragenen Lernprozesses, da Lerner aus Angst vor Versagen oder Bloßstellung die Freude am Lernen verlieren und sich nur noch auf die Rekonstruktion von vorgegebenen Lerninhalten beschränken, weil hier die Gefahr, Fehler zu machen, am geringsten erscheint. So wird ihnen die Möglichkeit genommen, selbstverantwortlich ihren Lernprozess zu gestalten und sich mit ihren Fragen und Interessen konstruktiv einzubringen. Dies aber ist eine Voraussetzung für die Entwicklung von Selbstvertrauen, selbstverantwortlichem Lernen und Handeln sowie einem stabileren Selbstwertgefühl. Wenn jeder Beteiligte mit dem Gefühl in die Klasse geht, mit all seinen Eigenschaften, Kompetenzen usw. ein Zentrum in der Gruppe zu bilden, also mit der Einstellung, dass seine Individualität einen ganz eigenen und einzigartigen Gewinn für die Klassengemeinschaft darstellt, kann er realisieren, dass jeder die Gruppe mit den ihm eigenen Ideen bereichern kann. Sobald Pädagogen zulassen können, dass jeder Teilnehmer (als ein Zentrum im oben genannten Sinne) seinen ganz eigenen, wertvollen Platz in der Gruppe einnimmt und damit jeder für den Lernprozess durch seine Individualität eine Bereicherung bedeutet, erst dann kann eine Atmosphäre von gegenseitiger Wertschätzung und Achtung innerhalb der Lerngruppe umfassend entstehen. Damit ein solches Ziel der gegenseitigen Wertschätzung erreicht wird, helfen klare Regeln im Umgang miteinander, die den gegenseitigen Respekt unterstützen. Diese Regeln sollten von allen (Lehrenden und Lernenden) eingehalten werden.
Grundsätzlich wird in einer konstruktivistischen Didaktik davon ausgegangen, dass jeder Beitrag in Lernprozessen von Bedeutung ist.
Dazu gehört zum Beispiel, dass jedem aufmerksam zugehört wird und niemand einem Redenden ins Wort fällt. Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten können ausgetragen werden, doch bei diesen Auseinandersetzungen sollte die Beachtung bestimmter Regeln vorausgesetzt werden, z.B. dass niemand ausfallend oder verletzend wird. Es gehört zu den demokratischen Basiserfahrungen, dass diese Regeln allerdings dann auch gemeinsam mit der Lerngruppe erarbeitet und aufgestellt werden sollten. Mittels eines solchen Rahmens, der selbst erstellt wurde, können Lerner stärkeres Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl entwickeln.
Die Entfaltung des Selbstwertgefühls ist eine unerlässliche Grundlage, um die Fähigkeit zu erwerben, Kritik zu ertragen und selbst fair Kritik zu äußern. Lehrende und Lernende entwickeln so die Kompetenz, Niederlagen und Fehler einzugestehen und einen positiven Gewinn aus ihnen zu ziehen. Sie lernen, Grenzen zu setzen und nein sagen zu können, wenn sie wirklich nein meinen. In einer Atmosphäre von Akzeptanz wird es für jeden leichter, zu ertragen, dass man nicht immer von jedem gemocht werden kann. Beziehungen sollten als stets veränderbar und fließend wahrgenommen werden können. (Vgl. Reich: Konstruktivistische Didaktik, 66 f.)
Neben diesen beispielhaft aufgezählten Achtungsregeln, die für ein fruchtbares Miteinander in pädagogischen Prozessen hilfreich sind, gibt es eigenständige Methoden, in denen Selbstverantwortung, Mitbestimmung und Selbsttätigkeit einen hohen Stellenwert besitzen. Uns sehr wichtig erscheinende Methoden werden in unserem Methodenpool gesondert dargestellt, wie zum Beispiel Klassenrat, Kinderparlament und Reflecting Team. Dort finden sich zur Darstellung und Durchführung zahlreiche Beschreibungen.
|