|
>> zurück zum Inhaltsverzeichnis und zur Auswahl der Kapitel |
III. Beziehungswirklichkeit
1. Selbst und Andere – Gedankenexperimente zur Unschärferelation
Beobachter beobachten sich selbst und andere. Sie sind Selbst- und Fremdbeobachter. Dabei sind sie stets vorgängig in kulturelle Strukturen und Codifizierungen einbezogen. Jeder Beobachter muss bedenken, dass er bereits erzogener Beobachtender ist. Diejenigen, die andere beobachten, wurden einst selbst beobachtet und, komplizierter hierin, sie betrachten auch während aller Beobachtung sich selbst, treten sich selbst in Vorstellungen und Gedanken entgegen, um sich als Mensch unter anderen Menschen gewahr zu werden. Die eigene Wahrnehmung an anderen (imaginär) und im Bild des Anderen (symbolisch) werden dabei zu Vergleichen herangezogen.1
Selbstbeobachter können von Fremdbeobachtern beobachtet werden, was die Perspektiven und Kreise der Beobachtung ins Unendliche erweitert und die klare, eindeutige Logik einer Beobachtung stets kränkt. Diese Kränkung habe ich in Band 1 in ausgewählten Beobachtungsgebieten nachvollzogen.
Auch im Bereich der Beziehungswirklichkeit operieren wir mit Zeichen, Worten, Begriffen, Aussagen. Diese, so hatte ich bereits gefolgert, sind gedankliche Konstrukte, die einem unterschiedlichen Abstraktionsniveau angehören. Gerade in den sozialen, gesellschaftlichen oder humanen Wissenschaften haben wir es nun weniger mit einem einfachen Abstraktionsniveau zu tun, etwa der Art, dass bestimmte Begriffe bestimmte Dinge bezeichnen, also etwa im Sinne der konventionellen Zuschreibung, dass ein Stift ein Stift, eine Tasche eine Tasche und ein Haus ein Haus sei. Auch solche scheinbar sicheren Zuschreibungen können, wenn wir strikt reflektieren,2 unsicher werden, aber im Alltag haben wir uns meist an eine ungefähre Übereinstimmung von Dingwelt und begrifflicher Welt gewöhnt. In unseren Beziehungen zu anderen Menschen – wir sprechen auch von Interaktionen –, können wir bei kulturell ähnlicher Sozialisation zumindest davon ausgehen, dass die Inhalte, die wir meinen, von anderen als solche erfasst werden können. Bei der Einleitung in die „Fremd- und Selbstbeobachtung“ (Band 1, Kap. I) haben wir die Auffassung von Elias kennengelernt, der bei der Beobachtung von Familie und sozialen Beziehungen von Verflechtung spricht. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass unsere Sprache durch ihre Verdinglichung weniger diese Verflechtungen und uns und die Anderen als Beobachter in diesen Verflechtungen beschreibt, sondern begrifflich vergegenständlicht und damit als etwas Statisches erscheinen lässt. So sprechen wir dann von Subjekt und Objekt, vom Abbild des Wahrgenommenen oder einer Widerspiegelung von Tatsachen, obwohl wir bei näherem Hinsehen gar kein gegenständliches Verhältnis festmachen können.
Für einige liegt hier die Versuchung nahe, diese scheinbar feststehenden Dinglichkeiten dadurch lehrbar und verstehbar zu machen, dass sie enge und eindeutige gesellschaftliche Normen an sie heften, um dann aussagen zu können, dass beispielsweise ein guter Beobachter immer eine Person sein muss, die in erster Linie auf die Einhaltung empirischer Sinnkriterien zu achten habe. Je eindeutiger dieses Normennetz gespannt wird, desto normativer wird die daraus resultierende Beobachtung. Der Positivismus und logische Empirismus sind hierin in der Beobachtungsgeschichte gewisse Höhepunkte solcher Entwicklung. Diese Sichtweisen habe ich in Band 1 als grundlegend gekränkt diskutiert.
Wenn wir uns nun der Beziehungswirklichkeit intensiver zuwenden, dann müssen wir, so scheint es mir, bemerken, dass die Statik von Begriffen hier ganz wesentliche Probleme für die Beobachterposition birgt.
Dies gilt zunächst auch schon für das Denken allgemein. So hat besonders Hegel darauf aufmerksam gemacht, dass wir die Begriffe, die scheinbar feststehend nur das bezeichnen, was wir an den Dingen auch tatsächlich nachweisbar sehen und empfinden können, verflüssigen müssen, wenn wir denken wollen. So mag z.B. der Begriff „Rose“ als eine feststehende Dingheit uns erscheinen, aber er bezeichnet für den Beobachter so unterschiedliche Stadien der Rose wie Keim, Knospe, Blüte und verwelkte Pflanze. Kulturell wird mit der Rose ein umfangreicher symbolischer Bedeutungshof von Assoziationen unterschiedlichster Art angesprochen, so dass wir die Wahrheit der Rose oder des Rosenmäßigen uns nur durch Abstraktion und Bewegung in den Abstraktionen erschließen können – und doch nie vollständig erreichen werden. Hegel sagt, dass der einen Seite des Begriffs, dem Eins, also dessen, was genau ein Begriff bezeichnet, immer viele Auchs entgegenstehen, also Eigenschaften, die mit diesem Eins verflochten sind und es ergänzen, spezifizieren, abwandeln, die aber zum Prozess des Lebendigen unbedingt dazugehören (vgl. Kapitel II.1.1).
Noch deutlicher wird dies bei der Redeweise Mensch. Was ist ein Mensch? Zwar kann ich gattungsgeschichtlich eine allgemeine Antwort geben, aber ich weiß von meinen unterschiedlichen Beobachterpositionen so viele Arten und Eigenschaften des Menschlichen, dass ich nur durch eine Verflüssigung meiner Gedanken in der Lage bin, über Menschliches zu sprechen. Unsinn wäre es hier, das Menschliche ausschließlich auf ein Eins eines Wissens beziehen zu wollen, da menschliches Leben niemals nur Eins ist.
Aber ist es beim Studium von Beobachterstandpunkten in der Beziehungswirklichkeit nicht doch notwendig, dass wir uns auf das Eins konzentrieren? Will und muss man nicht die grundlegenden Definitionen wissen, die ein jeweiliger Beobachterstatus bietet, um damit in aller Zukunft zu arbeiten? So könnten wir jetzt im Sinne eines Lexikons oder einer Enzyklopädie eine Indexliste fertigen und uns begriffliche Konventionen aneignen, um im Reigen der Zitate und im Kartell der sich Zitierenden mitreden zu können.
Gewiss, es wird nicht ausbleiben, dass wir uns Begriffe aneignen. Aber ein zusammenhängendes Bild gerade unserer Beziehungsseite wird uns daraus nicht entstehen, sondern vielmehr ein zu einfaches Wissen, das immer dann, wenn wir einen Begriff auf seine Auchs hin untersuchen, in vielfältige Blickrichtungen bzw. Beobachterpositionen zerfällt. Einfache Vorstellungen erleichtern uns das Erfassen bestimmter Zuordnungen und Abstraktionsebenen, auf denen wir gedanklich und beobachtend operieren, um unsere logischen Schlüsse zu ziehen. Aber nicht nur dem Anfänger in solcher Denkweise fällt es schwer, sich wieder aus dem Korsett solcher Konstruktionen zu lösen, weil sie zu statisch, zu absolut im Blick auf das veränderliche Treiben, zu reduktiv im Blick auf die potenziellen Blickwinkel gegenüber beobachtbaren Phänomenen sind. Dies will ich an zwei besonders instruktiven logischen Beispielen verdeutlichen. Sie sollen uns helfen, Unterscheidungen festzulegen, die für den gesamten weiteren Verlauf unserer Überlegungen über die Beziehungswirklichkeit richtungsgebend sein werden.
1.1. Exemplum 1: das Gefangenendilemma der gefesselten Gefangenen
a) Beschreibung des Gefangendilemmas
In einem Gefängnis ruft der Gefängnisdirektor drei Gefangene zu sich und erklärt ihnen: „Aus Gründen, die ich Ihnen nicht darlegen will, soll einem von Ihnen die Chance gewährt werden, noch heute die Freiheit zu erlangen, die Sie alle verdient haben. Dazu müssen Sie in ein Experiment einwilligen, in dem Sie ein Rätsel zu lösen haben. Derjenige von Ihnen, der als erster durch Nachdenken oder Zufall auf die richtige Lösung kommt, wird sofort freigelassen.“
Die Gefangenen willigen, ohne nachzudenken, ein, denn die Freiheit ist ihr größter Wunsch. Der Gefängnisdirektor bestimmt daraufhin folgendes:
Die Gefangenen werden hintereinander an Stühlen gefesselt, so dass der hinterste den Rücken seiner beiden Vorderleute sehen kann, der mittlere sieht nur den Rücken des direkten Vordermannes, der vorderste sieht die Wand. Der Gefängnisdirektor tritt hinzu und sagt:
„Es gibt fünf Scheiben, drei schwarze und zwei weiße. Ich habe Ihnen je eine auf dem Rücken befestigt, und wer von Ihnen mir sagen kann, welche Scheibe er auf dem Rücken trägt, der kommt frei. Wissen Sie keine Antwort, so bekennen Sie es offen. Sie werden dann ihre normale Gefangenschaft zu Ende bringen. Wird allerdings falsch geraten, so soll die weitere Gefangenschaft verdoppelt werden.“
Der hinterste Gefangene sieht auf dem Rücken seiner beiden Vorderleute zwei schwarze Scheiben. Er weiß daher, dass es noch eine schwarze und zwei weiße Scheiben gibt. Da fragt ihn der Gefängnisdirektor:
„Welche Farbe trägt die Scheibe auf Ihrem Rücken?“
Der Mann überlegt. Er müsste raten, denn sie könnte sowohl schwarz als auch weiß sein. Doch das Risiko einer Verdopplung seiner Strafe ist ihm zu groß. Er sagt:
„Ich weiß die Farbe nicht zu sagen.“
Und er denkt sich: Wenn er doch bloß die zwei weißen Scheiben vor mir angebracht hätte, dann wäre die Lösung für mich leicht gewesen.
Das denken die beiden anderen Gefangenen auch.
Nun geht der Gefängnisdirektor zu dem mittleren Gefangenen. Er fragt wieder:
„Welche Farbe trägt die Scheibe auf Ihrem Rücken?“
Der Mann überlegt. Wenn seine Scheibe und die des Vordermannes weiß wären, dann hätte der hinterste Mann seine Farbe gewusst. Da sein Vordermann jedoch eine schwarze Scheibe trägt, so konnte der hinterste seine Farbe nicht wissen, wenn er selber entweder eine schwarze oder weiße Scheibe trägt. Hier hört er jedoch mit seinem Nachdenken auf, denn zu trügerisch erscheint ihm das mögliche Glück, jetzt auf eine Farbe zu tippen. Er sagt also:
„Ich weiß die Farbe nicht zu sagen.“
Nun geht der Gefängnisdirektor zum vordersten Gefangenen und legt freundlich seine Hand auf dessen Schulter. Er fragt zum letzten Mal:
„Welche Farbe trägt die Scheibe auf Ihrem Rücken?“
Da erhält er sofort die richtige Antwort.
„Schwarz!“
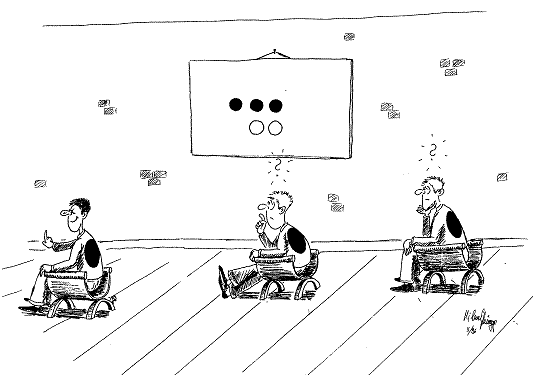
b) Lösung des Gefangenendilemmas
Das Gefangenendilemma lässt sich mittels logischer Schlussfolgerung recht einfach lösen, vorausgesetzt, die Gefangenen halten sich an elementare logische Regeln. Durch die Fesselung – eine spezifische Laborbedingung übrigens auch bei den meisten wissenschaftlichen Experimenten – erhalten sowohl die Gefangenen als auch wir als externe Beobachter Gelegenheit, die Bedingungen und die Abfolge des zu Bezeichnenden immer enger zu fassen. Wenn der erste Gefangene gewusst hätte, welche Farbe er trägt, dann hätte ihm der Gefängnisdirektor einen großen Vorteil dadurch verschaffen müssen, dass er zwei weiße Scheiben vor ihm platziert hätte. Da dies nicht der Fall war, wusste der zweite Gefangene, dass seine Scheibe entweder schwarz oder weiß sein müsste. Da er die schwarze Scheibe seines Vordermannes sah, konnte er denken, dass vielleicht zwei schwarze übrig sind. Da es keine weiße war, die er vor sich sah, blieben ihm zwei logische Möglichkeiten: schwarz oder weiß. Wenn er nun sagt, dass er seine Farbe nicht kennt, so musste er, dies konnte der dritte Gefangene schlussfolgern, die schwarze Scheibe vor sich haben.
Warum der Gefängnisdirektor den dritten Gefangenen dermaßen bevorzugte, das wissen wir nicht. Warum die beiden anderen nicht versuchten, trotz der angedrohten Verdopplung der Strafe zu raten, darüber will ich als Beobachter keine weiteren Vermutungen anstellen.
c) Einige Schlussfolgerungen
Aus dem Beispiel sollen nun einige Schlussfolgerungen gezogen werden. Ich will dabei eine Konstruktion wählen, die uns zugleich einiges über methodologische Möglichkeiten der Forschung verraten soll.
Wie erscheint die Anwendung der logischen Regeln, die die drei Gefangenen mehr oder minder intuitiv anwenden konnten, aus ihrer jeweiligen Sicht?
Der erste Gefangene repräsentiert eine „frühe“ Form des Wissens. Er sieht und empfindet zwar die Situation einer mehrstelligen Logik, kann jedoch die Variablen noch nicht klein genug halten. Nun besteht aber das Wesen eines jeden Experimentes darin, die Bedingungen möglichst so einzuschränken, dass es nur eine eindeutige, von allen gleichermaßen beobachtbare und damit intersubjektiv nachprüfbare Antwort gibt. Wenn sich alle hier an die Regeln halten, dann kommt es unter der Verwendung gleicher Bedingungen wiederholt zum gleichen Ergebnis. In der Forschung nennt man dies auch empirisches Sinnkriterium, und das Wesen der meisten Laborversuche läuft darauf hinaus, solche Bedingungen zu erstellen, die kausal eindeutig beobachtbar sind. Unser erster Gefangener hat hierbei keine Chance. Er kann nur raten, aber die Versuchsanordnung verbietet dies durch Androhung von Strafe.
Der zweite Gefangene kann sich bereits auf die Versprachlichung seines Vorgängers berufen, er ist nicht allein seiner sinnlichen Beobachtung ausgeliefert. Dennoch fehlen auch ihm noch entscheidende Einschränkungen des zu Beobachtenden, so dass er letztlich nur mit Glück richtig hätte raten können. Selbst wenn ihm der hinterste Gefangene irgendeinen Vorschlag verbal unterbreitet hätte, so wäre er darüber ins Zweifeln gekommen, denn es hätte sein können, dass er ihn täuscht, weil er auch selber nur raten kann. So vertraut auch der mittlere Gefangene nur seinen Beobachtungen.
Der dritte jedoch ist in seiner konstruierten Logik den Äußerungen seiner Vorgänger ausgeliefert. Hätten sich diese nicht an die Regeln der Beobachtung gehalten, so käme er zu falschen Schlussfolgerungen. Seine sinnliche Gewissheit kann zu keiner direkten bzw. unmittelbar nur von ihm kontrollierten Wahrheit finden, aber durch die Summe der Beobachtungen anderer Beobachter zieht er den eindeutigen Schluss, der seine Befreiung bedeutet. Für ihn ist es daher wesentlich, dass seine Vorgänger sich gültig an die Regeln der Beobachtung und Logik halten. Er wird in seiner Entscheidung hierauf vertrauen und nur der Misserfolg wird ihn eines Besseren belehren können. Er wird daher – in seiner Position – wahrscheinlich der eifrigste Verfechter wissenschaftlicher Normierung und Gültigkeit von Experimenten sein. Alles ist ja auch darauf angelegt, dass er allein es sicher schafft.
Der Gefängnisdirektor repräsentiert in unserem Beispiel hingegen eine steuernde, auswählende Form des Wissens, er ist der eigentliche Experimentator, einer göttlichen Figur gleich, und seiner Konstruktion sind die Gefangenen ausgeliefert. Zudem hat er sein Experiment so angelegt, dass er bereits eine Hypothese hatte, wer wohl zur Lösung kommen müsste, denn sein Experiment folgte einer Logik, die die anderen bloß rekonstruieren konnten. Zwar hätten sie davon auch abweichen können, indem sie sich untereinander beispielsweise verständigt hätten, aber der Direktor vertraute (im Muster des Gefängnisses, der Disziplinierung) auf das menschliche Gegeneinander, da er von unterschiedlichen Lebensinteressen ausgehen durfte.
Ein weiterer Umstand verdient es, festgehalten zu werden: Im Experiment, das nach dieser eindeutigen Kausalität strebt, um sich daraus Regeln der Logik, wahre Erkenntnisse abzuleiten, geht es darum, die Beobachterpositionen scharf voneinander zu trennen. So darf der Gefangene, der, mit dem experimentiert wird, immer nur das wahrnehmen, was die eingeschränkte Logik und Konstruktion des Experiments gestattet. So wäre unser Gefangenenexperiment sinnlos, wenn Außenstehende durch Zuruf Hinweise geben würden. Solche störenden Bedingungen ließen alle Kontrollierbarkeit aus den Fugen geraten. Auch muss der Experimentator sich seiner eigenen Beobachtungen, gegebenenfalls mittels technischer Hilfsmittel oder weiterer eingeweihter Beobachter, versichern, um die erwartete Beobachtung festzuhalten und kontrollierbare Schlüsse daraus zu ziehen. Sollten aber die Gefangenen sich nicht auf die Logik verlassen, sondern nach spontaner Zufälligkeit ihre Wahl entscheiden, dann wäre unserer Experimentator in seinen Schlussfolgerungen gescheitert: Er beobachtet nämlich immer nur das, was er irgendwo und irgendwie erwartet hat. Sollten andere Äußerungen erscheinen, so wird er sie als störend bemerken und auszuschließen versuchen.
Wenn Foucault nach der Herkunft von Irrenhäusern, Krankenhäusern und Gefängnissen fragt und dabei die Frage nach der Rolle der Disziplin und Disziplinierung aufwirft, wenn er erkennt, dass dies immer Institutionen der Macht sind, dann sollten wir bedenken, dass diese Analysen nur sichtbare Spitzen eines Eisberges sind. Solche Analysen begründen sich in der Moderne aus dem Diskurs der Universität bzw. des Wissens. Unser Gefängnisdirektor ist nur eine äußere Figur, eine Metapher für jemanden, der alles weiß, weil und insofern er die Bedingungen des Experimentes in seinen Händen hält. Aber welche Instanz setzt Personen wie unseren Gefängnisdirektor eigentlich ein?
In einer arbeitsteiligen Welt erwarten wir von allen, die Daten über die Wirklichkeit zu gewinnen versuchen, dass sie eindeutige Aussagen treffen. Dort, wo wir mit Dingen zu tun haben, werden solche Verdinglichungen unserer gezielt beobachtenden Wahrnehmungen zum technischen Fortschritt. Dies werde ich später in Kapitel IV ausführlich diskutieren. In den Verhaltenswissenschaften ist gegenüber Verdinglichungen immer Skepsis angebracht, denn hier können Menschen leicht mit Dingen verwechselt werden, was zu einer unmenschlichen Gefangenschaft führt. Insoweit ist unser Beispiel einer Gefangenschaft auch nicht zufällig.3 Der Diskurs des Wissens verführt immer wieder dazu, sich Menschen als Versuchsobjekte zu konstruieren. So gesehen repräsentiert der Gefängnisdirektor in unserem Beispiel die Wissenschaft, die institutionell mit gesellschaftlichen Erwartungen und Strukturen verbunden ist. Dies geschieht – wie die Analysen Foucaults zeigen (vgl. Kapitel IV.3.3.2.1) – in keinem Bereich machtfrei. Es erzeugt Gefangenschaften. Gleichwohl ist der Gefängnisdirektor kein Absolutum. Er ist eingesetzt und staatlich kontrolliert.4
Damit bleiben wir als beobachtende Instanz neben dem Gefängnisdirektor. Wir gewinnen anders als er in unserer Interpretation Schlussfolgerungen aus unseren Wahrnehmungen. Genauer muss ich von meinen Beobachtungen und den Beobachtungen derjenigen sprechen, die dieses Beispiel lesen. Auch könnten wir an eine imaginäre Tafel noch ein beobachtendes Auge einzeichnen, um all jene Beobachterpositionen zu bezeichnen, die uns wiederum in unserer Beobachtungssituation beobachten.5 Es ist unvermeidlich, überhaupt eine Beobachterposition einzunehmen, obwohl der Aktivitätsgrad solcher Positionen stark schwanken kann. Aber wir nehmen immer in unserem Leben wahr, wobei solche Wahrnehmung zu einer Selbst- und Fremdbeobachtung gerät, der wir nicht ausweichen können.
Die Wissenschaft aber verführt uns gerade in den Verhaltenswissenschaften dazu, möglichst schnell die Position des Gefängnisdirektors einzunehmen, weil wir von dieser Position aus die Regeln des wissenschaftlichen Prozesses am besten kontrollieren können. Dies erscheint als rational. Und den möglichen Vorwurf subjektiver Willkür begrenzen wir sehr oft durch den Verweis auf die Möglichkeit aller zugelassenen Beobachter. Dies erscheint als demokratisch. Vernünftig jedoch handeln diese in der Demokratie nur, wenn sie subjektiv übereinstimmen und sich auf die Richtigkeit bestimmter Wahrnehmungen einigen können. In solcher Übereinstimmung als Beobachter sehen wir einen scheinbar ganz gewöhnlichen logischen Vorgang. Wir durchschauen die Intentionen der Gefangenen und erblicken den Gefängnisdirektor als eine lenkende Figur. Mögen wir auch die Intentionen von Gefängnissen und solchen Aufgaben insgesamt kritisieren und ihre Notwendigkeit bezweifeln, so zweifeln wir doch nicht an der darin liegenden zwingenden Logik, und wir müssen uns in unserer Beobachtung eingestehen, dass wir von keiner der anderen Positionen aus zu anderen logischen Schlussfolgerungen gekommen wären. Hier haucht uns die Macht der Wissenschaft an: Es sind unausweichliche logische Konstruktionen, die offenbar für keine der noch so beliebigen Beobachterpositionen Ausnahmen in der Schlussfolgerung zulassen. Gleichwohl mag uns ein Unbehagen beschleichen, ob hier denn jedes Experiment zugelassen sein sollte, um solche Art Logik immer weiter zu treiben.
Bilden wir nun eine Analogie zur empirischen Forschung, dann fällt auf, dass im 20. Jahrhundert die Verhaltensforschung, sehr oft als Tierforschung organisiert, ähnlichen Konstruktionen folgte: Ein Experimentator lässt Gefangene bestimmte Operationen ausführen, um hieraus Regeln des Verhaltens abzuleiten. So etwa hat der berühmte Verhaltensforscher Skinner seinen Ratten durch konsequente Belohnung gezielt Verhalten beibringen können und daraus allgemeine Schlussfolgerungen über die Lernfähigkeit gezogen und durch Analogieschluss auf Menschen übertragen. Es erwies sich beispielsweise, dass Lernen durch positive Verstärkung, etwa Futtergabe, erfolgreicher ist als Lernen durch Bestrafung, etwa Misshandlung. Solche Schlussfolgerungen wiederholten, was Pädagogen über Jahrhunderte in pädagogischer Praxis auch bereits als Erfahrungsschatz angesammelt hatten. So war bemerkt worden, dass je mehr die Erziehung im Dilemma einer Gefangenschaft der Kinder erfolgte, also in von der Lebenswelt künstlich isolierten Orten – Schulen –, Lob erfolgreicher Lernen stimulierte als die Prügelstrafe.6 Immer gab es Beobachter und Beobachtete, immer darin Rollen der Gefangenschaft und der Direktion solcher Gefangenschaft, immer sind wir von heute aus Beobachter solcher Ereignisse.
Aber was diese Denkweise in der Technik erreicht hat – und auch hier ist Skepsis im Blick auf gewisse nicht berechnete oder berechenbare Folgewirkungen angebracht –, das hat sie in den Verhaltenswissenschaften nicht vollbringen können. Sollte solche Logik im menschlichen Verhalten nämlich funktionieren, dann hätte eine durch die Jahrtausende währende gegenseitige menschliche Beobachtung in Erziehungs- und Verhaltensdingen eigentlich eine Logik menschlichen Handelns hervorbringen müssen, die zu vollständigen und richtigen Lösungen tendiert. Wir müssten wissen, wie man erfolgreich jemanden dazu bringt, wie er werden soll. Nur kann dabei das Individuum nicht als Einzelfall betrachtet werden. Damit müssten wir aber klar definieren können, wie alle Menschen werden sollten. Doch kann ein solches Fortschrittsmodell gelingen?
Es ist offensichtlich, dass wir weder über eine solche Logik verfügen noch wissen, wie wir eigentlich werden sollten – zumindest sind die Ansprüche auf solches Werden vielfältig und in neuerer Zeit zunehmend widersprüchlich. Ja, wir können geradezu feststellen, dass uns in kritischer Reflexion jene Sekten und Gruppierungen eher abstoßen, die sich selbst eine solche Logik konstruieren, um sicher durchs Leben zu gehen, d.h. Leute, die sehr genau wissen, wer sie sind, was sie wollen und Andere verachten, die ihnen nicht folgen. Gerade bei ihnen sehen wir die Fesselung und die Gefangenschaft am deutlichsten, in der ihre Mitglieder stehen. Auch benötigen sie Führer wie unseren Gefängnisdirektor, die dann willkürlich über ihr Leben entscheiden.
Da folgen wir – insbesondere als Konstruktivisten – lieber einem anderen, angemessenerem Weg. Im künstlichen Labor, in einer isolierten Laborwelt, mögen Experimente denkbar und möglich sein. Aber Menschen sollten davon eigentlich ausgenommen werden, zumindest bei so existenziellen Fragen wie in unserem Beispiel. Wir wollen als Subjekte in unserer Beobachterposition gefragt werden. Zumindest wollen wir in unserem Leben Rollen erlernen, die uns angeben, wo Fragepositionen erlaubt sind, und wir erwarten von der Wissenschaft, dass sie darüber Rechenschaft führt. Dies liegt daran, dass wir in den Verhaltenswissenschaften ein gänzlich anderes Gefangenendilemma als das bis jetzt konstruierte erleben. Es ist – mit anderen Worten – diesem Leben zu wenig angepasst und isoliert eine künstliche Laborwelt, die ich wenig auf alltägliches menschliches Verhalten übertragen kann. Zwar werden hier nicht alle Forscher an den Universitäten einverstanden sein, aber ein großer Teil gerade in den Verhaltenswissenschaften, in der Erziehungswissenschaft, Psychologie, Soziologie und Philosophie, werden dieses Problem ähnlich sehen. Irgendwie brauchen wir die Logik zwar, die wir eben als Handlung rekonstruiert haben, aber irgendwie müsste sie auch anders als die eben beschriebene sein. Um dies zu illustrieren, möchte ich daher die Versuchsbedingungen ändern und ein zweites Beispiel geben.
1.2. Exemplum 2: das Gefangenendilemma der umherlaufenden Gefangenen 7
a) Beschreibung des Gefangendilemmas
In einem Gefängnis ruft der Gefängnisdirektor drei Gefangene zu sich und erklärt ihnen: „Aus Gründen, die ich Ihnen nicht darlegen will, soll einem von Ihnen die Chance gewährt werden, noch heute die Freiheit zu erlangen, die Sie alle verdient haben. Dazu müssen Sie in ein Experiment einwilligen, in dem Sie ein Rätsel zu lösen haben. Derjenige von Ihnen, der als erster durch Nachdenken oder Zufall auf die richtige Lösung kommt, wird sofort freigelassen.“
Die Gefangenen willigen, ohne nachzudenken, ein, denn die Freiheit ist ihr größter Wunsch. Der Gefängnisdirektor bestimmt daraufhin folgendes:
Die Gefangenen sind in einem Raum eingeschlossen, wobei jeder die Anderen sehen und sich frei bewegen kann. Draußen stehen Beobachter, die sie von einer Seite aus unbemerkt sehen können. In einer Ecke des Raumes ist eine Tür, dahinter ein Wärter. Der Gefängnisdirektor tritt hinzu und sagt:
„Es gibt fünf Scheiben, drei schwarze und zwei weiße. Ich habe Ihnen je eine auf dem Rücken so befestigt, dass Sie sie nicht selbst sehen können. Wer von Ihnen als erstes dem Wärter hinter der Tür sagen kann, welche Scheibe er auf dem Rücken trägt, der kommt frei. Wissen Sie keine Antwort, so gehen Sie nicht zu dem Wärter. Sie werden dann ihre normale Gefangenschaft zu Ende bringen. Wird allerdings falsch geraten, so soll die weitere Gefangenschaft verdoppelt werden.“
Alle Gefangenen erhalten eine schwarze Scheibe.
b) Lösung des Gefangenendilemmas
Nun wird den Gefangenen genug Gelegenheit gegeben, umherzulaufen und sich zu beobachten. Da jeder gegen jeden arbeiten muss, verbietet es der Versuch bereits, dass sie miteinander reden. Da die Strafe zur Verdopplung ansteht, wenn die falsche Farbe genannt wird, bemühen die Gefangenen die Eindeutigkeit der Logik, mit der sie auf ihre Farbe schließen können.
Sollte einer von ihnen auf dem Rücken der beiden Anderen weiße Scheiben entdecken, dann würde er unverzüglich dem Ausgang zustreben.
Aber nun wissen die Anderen hiervon. Sollten sie auch nur eine unverzügliche Bewegung zum Ausgang eines von ihnen zum Wärter bemerken, dann könnten sie an diesem vorbei stürzen, weil sie dann, wenn sie selbst eine schwarze und eine weiße Scheibe gesehen hätten, wüssten, dass sie nur noch eine weiße Scheibe tragen können.
Sollten sie aber nun eine gewisse Zeit sich beobachten und umeinander herlaufen, dann müssten sie aus logischer Schlussfolgerung eigentlich alle zum Wärter gehen und sagen: „Ich bin ein Schwarzer! Denn ich habe beobachtet, dass die Anderen schwarze Scheiben tragen. Würde ich nun eine weiße Scheibe tragen, so hätten beide dies bemerkt und wären möglichst bald dem Ausgang zugestürzt. Sie hätten dann nämlich folgendermaßen gedacht: Wenn auch ich ein Weißer wäre, dann hätte derjenige, der zwei weiße Scheiben beobachtet hätte, sich sofort zum Wärter begeben. Da dies aber nicht geschah, sondern ein gewisses Zögern einsetzte, kann ich logisch schließen, dass erstens die Anderen nicht zwei weiße Scheiben beobachten konnten, auch nicht einer von ihnen eine schwarze und eine weiße, was ihm gesagt hätte, dass er nur ein Schwarzer sein könne, so dass feststeht, dass wir alle drei Schwarze sein müssen.“
So wären im perfektesten Fall alle zugleich hinausgegangen. In Wirklichkeit wird aber wohl jener gewonnen haben, dessen logische Schnelligkeit und motorische Fertigkeit den Anderen überlegen war.
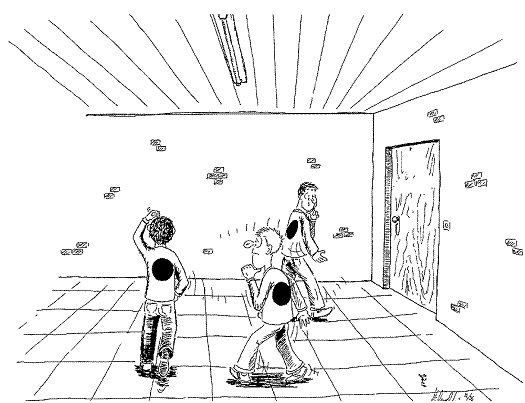
c) Konsequenzen aus den Gedankenexperimenten
Auch aus diesem Beispiel will ich Schlussfolgerungen ziehen. Lacan beschreibt das hier beobachtbare Dilemma als eine Schlüsselszene neuerer Psychologie. Wir werden bei der Interpretation sehen, dass er uns damit das Tor zu einer Welt öffnet, die einem Verständnis von Wahrheit in der Beobachtung von Verhalten angemessener entspricht, als wir dies im Beispiel der gefesselten Gefangenen zu entwickeln vermochten.8
Gehen wir noch einmal zurück zu unseren gefesselten Gefangenen, dann zeigt die Versuchsanordnung dort eine wichtige Vorbedingung für kausale Schlussfolgerungen: Die Gefangenen A, B und C können nacheinander ihre Schlussfolgerungen ziehen. Eins baut logisch auf dem anderen auf. Stellen wir unsere Gefangenen nun nebeneinander, dann fällt es ihnen deutlich schwerer, das Nacheinander der logischen Argumente zu vollziehen. Ein von mir mehrfach dergestalt durchgeführtes Experiment mit Studenten konnte dies bestätigen. Das zweite Experiment erwies sich als ungleich schwieriger als das erste, weil der soziale Druck die Gefangenen eher zum Raten als zum logischen Schließen veranlasste. Aber bilden wir uns einmal ein, dass die logische Vernunft so messerscharf entwickelt sei, dass selbst im Moment der Gefangenschaft und der angedrohten Folgen ruhige, aber schnelle Überlegungen gewährleistet sind.9
Was macht das Experiment so schwierig? Die logische Schlussfolgerung ist nicht nur an die Logik der Beobachtungen von schwarz und weiß geknüpft, sondern auch an die Beobachtung des (psychischen) Verhaltens der Mitgefangenen, sie ist also psychologisch.
Dabei wird zur Sicherung des logischen Nacheinanders im chaotisch erscheinenden Nebeneinander der umherlaufenden Gefangenen die Zeit als jene Variable eingesetzt (konstruiert), die Schlussfolgerungen über die Wahrscheinlichkeit der Farbe der Scheiben erlaubt und schließlich zur logischen Wahrheit führt. Sehen wir von einer äußeren Beobachterposition, etwa als Gefängnisdirektor von außen, die gestellte Aufgabe, dann erkennen wir mit einem Blick, dass es keine einwandfreie logische Lösung geben kann. Denn im Beispiel der gefesselten Gefangenen hatten wir die Angelegenheit so arrangiert, dass nach und nach die logischen Bedingungen eingeschränkt wurden: Zunächst wusste der letzte, dass es keine zwei weißen Scheiben gibt, weil sonst der erste die Antwort gewusst hätte; dann wusste er, dass der zweite keine weiße Scheibe sehen konnte, weil er sonst gewusst hätte, dass er eine schwarze haben müsste. Also war alles eindeutig nacheinander geordnet.
Nun aber ist im neuen Experiment eine solche Ordnung nicht möglich, denn das Verhalten gegeneinander verbietet das Sprechen, da sonst einer direkt gewinnt. Nur die Außenstehenden sehen alles in einem Blick. Die Gefangenen aber bemerken das Zögern, sie schauen in den Augen der Anderen die Unsicherheit, die mit zunehmender Dauer zur logischen Schlussfolgerung gerinnt:
- also erstens, wenn keiner sehr schnell geht, dann sind die Anderen, so wie ich es auch sehe, keine zwei Weißen;
- also zweitens, wenn ich aber ein Weißer wäre, dann würden die Anderen, die ich als Schwarze erkenne, beobachten, dass keiner schnell zum Ausgang rennt, was nur heißen könnte, dass sie Schwarze sind;
- da aber drittens keiner bisher gerannt ist, wo ich doch dies schon alles gedacht habe, kann ich, unter der Voraussetzung gleicher Gedankengeschwindigkeit und logischer Findigkeit bei den Anderen, davon ausgehen, dass ich ein Schwarzer bin. Wenn wir jetzt alle ganz langsam dem Ausgang zugehen und noch zögern, dann wird mir dies zur unumstößlichen Wahrheit.
Um diese Wahrheit zu erreichen, sind also drei Zeitbrechungen notwendig, die die Gefangenen beobachten und die auch wir Außenstehende an ihren Reaktionen bemerken können. Die erste Brechung schließt die schnelle Lösung aus. Es gibt keine klar erkennbaren zwei Weißen. Die zweite Brechung bezeichnet den wechselseitigen Zweifel, der als Folgerung der ersten Brechung einsetzt und die Gedanken einen Schritt weiter führt. Der je Betroffene kann schwarz oder weiß sein, aber die Reaktionen der Anderen sind noch unsicher, so wie meine auch. Es ist logisch beides möglich: schwarz oder weiß. Unmöglich sind nur zwei Weiße. Aber dies denke nicht nur ich, sondern auch die Anderen. Es ist ein interaktives Spiel. Wenn ich weiß wäre, so sehen die beiden Anderen je einen weißen und einen schwarzen Gefangenen. Dann aber müssten sie denken, dass, wenn sie weiß wären, ja einer schon hätte rennen müssen, was jetzt völlig klar macht, dass sie nur schwarz sein können. Aber es rennt immer noch keiner. Die dritte Brechung wird sich über dieses Nicht-Rennen gewiss. Alle können nur schwarz sein, denn sonst wäre einer schon gerannt.
Die Zeit zum Begreifen ist den Konstruktionen, die die Gefangenen durchspielen, anzusehen, sie äußert sich körpersprachlich und in den Blicken. Die größte Schwierigkeit für die Gefangenen liegt in der Bestimmung der Zeitgrenze, die eine jeweilige logische Brechung reflektiert. Hier ist jedes Subjekt der eigene Konstrukteur seiner Farbe, indem er sich durch den Blick auf die anderen beiden versichert, was er selbst ist. Er erfährt dies, sofern die Anderen nicht schon hastig entschieden haben, wer sie im reziproken Spiel sind. Wer immer dieses Spiel zu simulieren versucht, der wird bemerken, dass nur im Belauern der Anderen die logische Zeit zu einer Assertion der eigenen Gewissheit nach schwarz oder weiß führt. Die Antizipation dieser Gewissheit wird nur durch den systemischen Bezug auf die Mitgefangenen erreicht. Sie bemisst sich in Zeit, die aber hier nicht nach dem Ticken der Gefängnisuhr, sondern nach dem Kontinuum der Fremd- und Selbstbeobachtung gewonnen wird, was allein eine Lösung dieses Experiments zulässt.
Damit wird das Unscharfe, das Unfassbare, ganz im Gegensatz zu einer Kausallogik des ersten Experiments, sichtbar. Das Subjekt mischt sich durch sein Tun, durch seine Artikulation, die überhaupt erst die Lösung der Aufgabe ermöglicht, in die Logik ein, „wodurch die Wahrheit, die es herausfindet, nicht zu trennen ist von dem Tun selbst, das davon zeugt.“ (Lacan 1980, 367)
Was logisch hier scheitern müsste, kann psychologisch erreicht werden. Und dabei zeigt sich ein fundamentaler Wandel der Logik: Was im ersten Gefangenendilemma noch als universelle Logik unter gleichbleibenden Bedingungen formuliert werden kann – die menschliche Logik zwingt uns einfach zu der hier konstruierten Lösung –, das bleibt im zweiten Beispiel genau dem Subjekt vorbehalten, das als erstes die Lösung für sich findet und nur über die Integration des Fürsichseins an sich behaupten kann. So hat der Gefängnisdirektor eine Bedingung geschaffen, die allein logisch nicht bewältigt werden kann, die aber psychologisch lösbar ist. Und diese Entscheidung verobjektiviert sich gegen Ende, nachdem die Zeit des Schließens vorüber ist und die antizipierte Gewissheit sich formuliert.
In Spielsituationen kann man beobachten, dass Teilnehmer, die sich aufgrund fehlender logischer Schnelligkeit noch gar nicht so gewiss sind, durch die Reaktionen der Anderen urplötzlich auch gedrängt sehen, dem Ausgang zuzuhetzen. Bei einigermaßen gleicher motorischer Geschicklichkeit kommen die Gefangenen aller Voraussicht nach recht gleich hier an. Aus den Bewegungen der Anderen kann dann geschlossen werden, dass man Schwarzer ist – und hier, jetzt am Schluss angekommen, entsubjektiviert sich der Akt des Schließens und externen Beobachtern drängt sich eine scheinbar der Logik des ersten Experimentes gleichende Logik auf. Auch die Psycho-Logik erscheint dann als eindeutig, objektiv, reduktiv und intersubjektiv wiederholbar. Alle erreichen sie aber nur in teilnehmender Beobachtung. Das Zögern und Sich-Beeilen werden plötzlich zu logischen Kategorien, die Gefühle, die mit ihnen verbunden sind, werden der Logik unterworfen und scheinen in dieser das zu repräsentieren, was der Gefängnisdirektor, was wir als ein Vertreter solch wissender Direktion, wissenschaftlich erwarten: Eindeutigkeit.
Nun ist aber die Eindeutigkeit, mit der sich unsere drei Gefangenen in diesem Experiment verhalten, bereits ein Konstrukt. Lacan setzt in seinem Gedankenexperiment hier ein universelles Verstehen für alle voraus, was aber dann scheitert, wenn sie nicht die Logik der Zeitbrüche durchschauen. Der Ablauf der Zeit zum Verstehen kann sehr unterschiedlich sein, die Eigenzeit der Subjekte im Verstehen mischt sich ein, und im mehrmaligen Nachstellen dieser Situation konnte ich erleben, dass erst im Nachhinein – bei logischer Rekonstruktion der eigenen Bewegungen durch Andere – die Zeitbrechungen vom Raten in eine zwingende Logik übertragen werden konnten. Erst nachdem das Subjekt die symbolische Logik erfasst hat – sie sozusagen in die Sprache seiner Psycho-Logik übersetzt – kann es seine eigene Imagination in Auseinandersetzung mit den Anderen besser einschätzen. Wird dann das Experiment wiederholt, dann kommt es nach einer sehr kurzen Phase des wechselseitigen Abschätzens immer schnell zu einer Lösung.
Zögern und Hast sind dabei Mechanismen, die sehr unterschiedlich den Subjekten zukommen und nicht von jedem gleichermaßen in Situationen übersetzt werden können. Nur wenn wir hiervon abstrahieren, erreichen wir die Eindeutigkeit unseres Experiments.
Logisch betrachtet aber ist unsere Lösung paradox. Unter Einführung der Zeit des psychologischen Schließens erhalten wir eine andere Wahrheit als die des ersten, reduktiven Kausalexperimentes. Wahrheit in der Form der Psycho-Logik kommt dem Irrtum zuvor, wie Lacan es ausdrückt (1986, III, 118), sie ist ein subjektiver Akt der Gewissheit, der die Bedingung hat, an das System der sich wechselseitig Beobachtenden geknüpft zu sein. Und stutzen wir nicht im Moment der Erkenntnis dieser Voraussetzung? Sind wir nicht als Beobachter dieses Beispieles selbst Beobachtende, die subjektiv schließen und sich Gewissheiten aus Folgerungen ablesen, die im seltensten Fall so eindeutig wie bei den gefesselten Gefangenen sind? Wissenschaft, so können wir uns auch erklären, ist ein Ort der Fesselung, der Reduzierung auf kleinste Einheiten des Beobachtbaren, um Antworten einer Logik erster Ordnung zu gewinnen, wie ich das Schließen in der Chrono-Logie des ersten Experimentes nennen möchte. Die Psycho-Logie aber beinhaltet eine Logik zweiter Ordnung, weil die in ihr angelegte Objektivierung nur in der Bewegung erzeugt und an subjektiven Momenten des sich Bewegenden festgemacht werden kann. Dabei steht in unserem einfachen Denkbeispiel die Zeit vor Augen, weil sie das Messinstrument für Aktion und Reaktion schlechthin ist, aber es können durchaus auch andere beobachtbare Zustände auftreten wie etwa Stärke und Qualitäten eines empfundenen Gefühls, das zwar auch eine Zeitkomponente aufweist, aber diese im Moment der Empfindung eher als nebensächlich erleben lässt.
Die Schwarz-weiß-Malerei unseres Beispiels ist zudem den meisten Verhaltensweisen von Menschen gegenüber viel zu primitiv, doch zugleich ist sie daher instruktiv und kann exemplarisch für Verhaltensforschung genommen werden, denn bereits das primitive Beispiel zeigt die Komplexität einer Logik zweiter Ordnung, die allein hinreichend subjektivierbare und daraus abgeleitete objektivierbare Konstruktionen von wissenschaftlicher Wirklichkeit uns entwerfen lassen wird.10
Auch in dem Experiment der Logik zweiter Ordnung bleibt uns ein Dilemma erhalten, das überhaupt ein Dilemma jeder Wahrheitssuche bleiben muss: Wir arrangieren ein Feld der Untersuchung, das wie der Ort des Gefängnisses eingegrenzt und in seinen Bedingungen beschreibbar, weil präzise beobachtbar, bleibt. Nehmen wir nun unseren gesamten Erdball als jenes Gefängnis, dann wären die Interdependenzketten der darauf wohnenden Menschen so komplex, dass wir nicht mehr präzise beobachten können, inwieweit die zeitliche Logik uns zu antizipierten Gewissheiten eindeutiger Natur führt. Dennoch zeigt unser einfaches Beispiel, dass wir als Menschen offenbar über Fähigkeiten verfügen, die uns solche Experimente überstehen lassen. Insoweit lauten anthropologische Folgerungen aus diesem Experiment:
(1) Im Laufe des menschlichen Lebens lernen wir die Psycho-Logik soweit, dass wir in der Lage sind, unser Selbst im Blick auf Andere in erkennbarer Qualität zu vergewissern, ohne darin jedoch eine universelle Gleichheit zu erzielen, denn in der Psycho-Logik unterscheiden wir uns.
Diese Qualität reicht gewiss weiter, als sich nach schwarz und weiß zu erkennen, markiert aber schon an unserem einfachen Gedankenexperiment, dass für alle Versuche, sich wissenschaftlich mit dem Verhalten des Menschen auseinanderzusetzen, neben eine unmittelbare Beobachtungslogik etwas Neues (nämlich die Beziehungs- oder Psycho-Logik) hinzutritt.
(2) Dabei können wir allerdings die engere Beobachtungslogik nicht einfach eliminieren. Schon unsere Welt der Begriffe, die sich auf das Eins des Bezeichneten bezieht, trügt uns, aber die Labors unserer wissenschaftlichen Welt sind grundsätzlich auf diesen „Betrug“ hin ausgelegt. Er schadet ja auch nicht in jedem Fall, sofern die Ebene der Abstraktion und der Gehalt der gewonnenen Information erörterbar bleiben. Leider ist dies nicht immer der Fall.
Eine weitere Schwierigkeit ist, dass man erst, wenn man sich eine ganze Weile der engeren Beobachtungslogik gewidmet hat, zu erkennen vermag, was die Beziehungs- oder Psycho-Logik überhaupt bedeutet. Bevor ich – in anderen Worten – die Grenzen der Komplexität bei der Beschreibung von Verhalten anerkennen kann, muss ich an engeren Beschreibungsversuchen von Verhalten teilgenommen haben, um die darin liegenden Gefahren der Vereinfachung mir bestimmen zu können. Zugleich eigne ich mir darüber jene notwendigen Begriffe an, die auch in der Beziehungs- oder Psycho-Logik verwendet, wenn auch mit neuen Bedeutungsmomenten versehen werden.
(3) Die Beziehungs- oder Psycho-Logik erfordert es, nicht in den Fehler zu verfallen, den Menschen als bloßes Ding oder als isolierbaren Gegenstand einer eindeutigen Objektivitätsbeschreibung misszuverstehen. Wir müssen von wissenschaftlichen Bemühungen dieser Logik fordern,
- dass das Subjekt immer erst für sich zu einer Behauptung an sich, also über Personen oder Sachen, gelangen kann, ohne je zu wissen, was genau ein Mensch oder der Andere oder man selbst ist, weil wir aus unserer Psycho-Logik hier immer nur durch Ausschlussforderungen wissen, was wir (zeitlich, räumlich, sozial usw.) nicht sind;
- dass wir erkennen müssen, dass wir in gewisser Weise wie die Gefangenen in unserem Beispiel auch Gefangene einer Beobachtungssituation sind, auch wenn wir es hier zum Meta-Beobachter (wie der Gefängnisdirektor) oder zum Beobachter dieses Beobachters bringen können; aber es gibt nie einen end-endgültigen Beobachterstandpunkt;
- dass wir uns wie die anderen Beobachtenden auch an bestimmte logische Erklärungen und sinnliche Erfahrungen und deren Interpretation in Zeit und Raum halten werden, was aber nicht ausschließt, dass es hier unterschiedliche Geschwindigkeiten, Reichweiten und Qualitäten geben mag. Dies stößt an die Grenze der Vermittelbarkeit unserer Gewissheit mit Anderen;
- dass der konstruktive Vorrat unserer Erklärungen uns und den Anderen eine Welt konstruiert, die für die wechselseitige Inanspruchnahme verwertbar bleiben muss, auch wenn diese Verwertung sich auf sehr kleine Personenkreise beschränken kann;
- dass unsere Konstruktionen einer ständigen Überprüfung durch andere Beobachter unterliegen, wobei wir in der Regel unsere Beobachtungen mit diesen abstimmen, was immer auch eine Regulierung unserer Konstruktionen bedeuten wird;
- dass die Logik der Zeit nicht nur in die kognitive Sphäre oder unsere Vernunft reicht, sondern uns als ganze Person einschließlich unserer Gefühle und psychischer Mechanismen anspricht, so dass wir es nie zu einer reinen, entmenschlichten Logik bringen können, wenn wir uns selbst zu erklären versuchen.
1.3. Konsequenzen für die Begründung einer zirkulären Beobachterlogik
Schließlich müssen wir noch einen Schritt weiter gehen und auch die Beziehungs- oder Psycho-Logik in Frage stellen. Was eigentlich würde geschehen, wenn sich die Gefangenen im gegenseitigen Abschätzen der Farbe der Anderen ansehen würden, aufeinander zugehen könnten und einer Diskurs führten, in dem sie sich einfach über alle Anordnungen hinwegsetzten? Sie könnten dann auf einfachste Art feststellen, welche Farbe sie auf dem Rücken tragen. Sie müssten sich nur einigen, auf einen Sieger zu verzichten, und sie würden den Gefängnisdirektor vor die paradoxe Situation einer gleichberechtigten Lösung stellen können, die er nicht erwartete.
Eine solche Kommunikationsform hat in der sozialwissenschaftlichen Forschung mehrere Namen aus verschiedenen Blickwinkeln erhalten. Habermas spricht vom herrschaftsfreien Diskurs, der dann möglich ist, wenn alle Sprechpartner sich gleichermaßen und ohne Macht über den Anderen zu beanspruchen, auf den Diskurs einlassen könnten. Es ist eine ideale Sprechsituation. Unser Gefängnisdirektor hat versucht, gerade diese auszuschließen, indem er die Interessen der Gefangenen gegensätzlich ausrichtete.
Diese ideale Sprechsituation lässt sich auf einer inhaltlichen Seite noch soweit herstellen, wie die Gefangenen wahrhaftig sprechen und zu folgerichtigen Aussagen gelangen. Die Wissenschaft betont solche Redeweisen als ein Konzept, das den möglichst herrschaftsfreien Zugang zum Wissen bewahrt. Doch setzen Wissenschaftler meist schon die zuvor gemachten Fesselungen voraus, bevor dies geschehen kann. Wir müssen uns in anderen Worten erst auf diese besondere Situation von Macht und Vorentscheidung einstellen, bevor die Idealität unserer Sprechgemeinschaft einsetzen kann. Das zweite Beispiel ist dem Lebensalltag näher, denn es zeigt frei umherlaufende Menschen in vorgegebenen Strukturen, ein Umstand, den wir alle kennen. In solchen Strukturen, auch diese Erfahrung machen wir, kommen wir allein mit Erklärungen aus wissenschaftlich-kausaler Sicht nicht hinreichend weiter. Hier gibt es einen Beziehungsgegensatz, der von vornherein solche idealtypischen Sprechbedingungen verstellt. Was könnten die Gefangenen allenfalls tun? Sie müssten sich aus dem Interessengegensatz lösen und – wiederum idealtypisch – zu einer Metakommunikation, d.h. einer Kommunikation über die Voraussetzungen ihrer Kommunikation eintreten. Aus einer Lösung erster Ordnung könnten sie dann in eine Lösung zweiter Ordnung übergehen. Was aber müssen sie dabei erkennen?
Zunächst müssen unsere Gefangenen erkennen, dass ihr bisheriger Lösungsversuch ein lineares Muster erzeugt und kausal nach Sieger und Verlierer ausgerichtet ist. Genauer in diesem Fall: Sie müssten erkennen, dass es nur einen Sieger geben kann und hierüber unzufrieden werden. Vielleicht könnten sie hierzu durch Kenntnis der Idee des herrschaftsfreien Diskurses veranlasst werden, vielleicht bleiben sie aber gerade ob des utopischen Charakters solcher Diskurse auch misstrauisch und hintergehen die Anderen. Nur Vertrauen in die gemeinsame neue Lösung kann zum Ziel führen.
Zugleich müssen sie sich aus der Fesselung durch die Logik erster Ordnung lösen, d.h. das Selbstverständliche, das Erwartete, das Vorkonstruierte verlassen und zu sich selbst kommen. Anderen wird dann ihr Handeln als spontan, paradox, unerwartet erscheinen, sie aber könnten hierin Selbstvertrauen finden, wenn sich alle daran halten. Hier sehen wir andererseits aber auch das Dilemma solch lebensweltlicher Forderungen: Man hält sich nur dann an ein solches Handeln, wenn man mindestens die Vision einer gemeinsamen Belohnung bzw. eines gemeinsamen Erfolgs (eines Lustgewinns welcher Art auch immer) imaginieren kann. Liegt dies nicht vor, dann wird solches Handeln äußerst unwahrscheinlich. Unser Gefängnisdirektor entspricht in seinen Forderungen durchaus der kapitalistischen Leistungsgesellschaft und einer Wissenschaft in dieser: Nicht alle sollen gleichermaßen gewinnen können. Wer am Ende gewinnen wird, dies scheint von unsichtbarer Hand gesteuert.
Zudem dürfen sie nicht nach Kausalketten suchen – etwa: Wer war länger im Gefängnis, wer ist schuldig oder unschuldig, wer ist älter oder jünger –, um ihre Lösung zu erreichen, sondern müssen sich auf das Hier und Jetzt ohne Vorbehalte beziehen.
Erreichen sie dies, dann wird ihr Lösungsversuch aus dem gestellten Dilemma, dem Teufelskreis der Versuchsanordnung, herausgeführt und auch für uns als äußere Beobachter als etwas Neues, als eine neue Logik erkennbar. Aber dies erfordert eine Revolution, die aus dem Blickwinkel der Lebenswelt als unwahrscheinlich erscheint: Die Struktur selbst muss bezweifelt und korrigiert werden. Die Gefahren, die strukturell vorgeordnet sind – die Androhung doppelten Gefängnisaufenthaltes in unserem Beispiel – müssen ignoriert werden. Dies bedeutet letztlich, das Gefängnis und seine Direktion abzuschaffen.
Im Sinne Foucaults, der gezielt die Macht in den Institutionen der Moderne aufgespürt hat, gilt die kritische Forderung, dass solche machtauflösenden Versuche wünschenswert sind. Sie sind bei einer auf Beziehungsgleichheit gerichteten Demokratisierung – im Sinne einer Freiheitsbeanspruchung – auch notwendig, um hegemoniale Macht zu verhindern, die Herausbildung von Machtmonopolen oder -zentren zu begrenzen, aber sie können andererseits nicht die Machtproblematik selbst beseitigen (vgl. Kapitel IV.3.3.2.1.). Hierfür gibt es mehrere Gründe:
- Je stärker die Autonomie der Subjekte betont wird, desto größer ist ihr gegenseitiger Freiheitsraum. Solche Gegenseitigkeit erzeugt unterschiedliche Interessen-, Motiv- und Bedeutungslagen, damit einen Raum von wechselseitiger machtvoller Beanspruchung. Im Idealfall bleiben Machtansprüche in einer Balance der Aushandelbarkeit, aber Macht verschwindet nicht durch Begrenzung. Sie wird allenfalls verkleinert.
- Eine Verkleinerung der Macht erzeugt aber durch die Regeln der Verkleinerung bereits neue Machtzusammenhänge. Unter der Perspektive einer Einigung hätten unsere Gefangenen beispielsweise darüber verhandeln können, wer von ihnen freikommen soll. Dies wäre selbst bei einem Handeln aus Einsicht mit der Erzeugung von Macht (bzw. Ohnmacht) des einen gegenüber den anderen Gefangenen verbunden. Oder sie hätten das Gefängnis samt Direktion beseitigen müssen. Auch das wäre nicht ohne Macht gegen den Direktor und seine Wärter gegangen.
- So scheint es vernünftig, die Strukturen der Macht zu begrenzen, um den Gefahren einer zu großen Unterdrückung zu entgehen. Aber besteht nun nicht gerade die Entwicklung der Kulturen darin, die Strukturen immer komplexer und feinmaschiger werden zu lassen, um als machtvolle Untermalung die Lebenswelt der Individuen zu berichtigen? Ist das zweite Gefangenendilemma nicht schlechthin das Sozialisationsdilemma der Post-Moderne? Sieger wird hier nur, wer die Zeitbrechungen im Blick auf eigene Interessen, Erkenntnisse und Schnelligkeit im Handeln durchschaut und umsetzen kann.
- Die Hintergründigkeit der machtvollen Strukturen geht dabei nie in der Vordergründigkeit der handelnden Subjekte auf. Sowohl dem Selbstbeobachter als auch dem Fremdbeobachter erscheinen unterschiedliche Bedeutungshorizonte von Macht. Die größten Freiheiten in der Post-Moderne bauen sich auf der Basis sehr fester Strukturen der Lebenswelt auf: Geld, Institutionen, Besitz- und Produktionsverhältnisse, Rollen und Habitus – oder wie auch immer wir die Beobachterperspektiven setzen wollen – regulieren strukturell die Möglichkeiten von Handlungen, die aus einer engeren Perspektive als frei, ungezwungen, kreativ usw. erscheinen. Deshalb wird es für den interaktionistisch-konstruktiven Ansatz insbesondere darauf ankommen, beide Perspektiven je aus ihrer Sicht zu schauen (Kapitel III. Beziehungswirklichkeit wird die subjektiven Sichtweisen betonen; Kapitel IV. Lebenswelt die eher verobjektivierten), um beide Sichtweisen im Rückschluss miteinander vermittelt zu denken.
- Selbstbeobachter und Fremdbeobachter können bei der Analyse solcher Vorder- und Hintergründe in ihren Beobachtungen oft nicht zu einem Konsens gelangen. Die Selbstbeobachter verharren schnell in der Gefangenschaft des Gewohnten. Will ich ihnen nun meine Erkenntnis als Fremdbeobachter aufzwingen, dann werde ich mit der lieb gewonnenen Seite von Gefangenschaften Erfahrungen machen: Sie versichern das Handeln einer Gewohnheitsbildung, einer Vertrautheit, einer Ordnung, die sich schwer auflösen lässt. Wir haben ja als fundamentale Einsicht in die Psycho-Logik uns festgehalten, dass sie nur vom Subjekt für sich erkannt und dann umgesetzt wird, nicht aber im Sinne einer engeren Beobachtungslogik von uns in die Köpfe Anderer eingesetzt werden kann. So wird im Blick auf die eingreifenden Mächte die unterschiedliche Perspektive mit unterschiedlichen Interessen- und Motivlagen zur Infragestellung einer Verständigung, die zu definieren hätte, welches Maß an Macht- oder Herrschaftsfreiheit notwendig wäre. Das Dickicht der Lebenswelt verstellt hier die freien (illusionären) Blicke auf einen Horizont.
Fassen wir unsere beiden Beispiele noch einmal zusammen: Das erste Beispiel zeigt uns eine gewohnte, wissenschaftliche Logik, wo eins aus dem anderen folgt, wo nach- und nebeneinander richtig geschlossen wird, indem die Begriffe geklärt und die Bedingungen so begrenzt werden, dass wir zu eindeutigen Aussagen kommen. Im Alltag üben wir solche Logik gegenüber Dingen und der Technik; auch im Verhalten kennen wir diese Logik, soweit unser Verhalten durch Rechtsnormen und Regeln sanktioniert ist; in der Wissenschaft scheint diese Logik den Fortschritt schlechthin zu symbolisieren.
Das zweite Beispiel zeigt, dass wir immer dann, wenn wir uns dem Lebensalltag nähern, komplexe Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen, wobei wir zwar noch die erste Logik benutzen, zugleich aber immer auch auf unsere Beobachterposition im Blick auf den Anderen und in der eigenen Selbstwahrnehmung achten müssen, wenn wir uns zurecht finden wollen. Sozialisation, Interaktion und Kommunikation sind Schlüsselbegriffe, die uns signalisieren, dass wir in den Verflechtungszusammenhängen mit Anderen, in der Interdependenz mit Anderen und damit zusammenhängenden Handlungsketten nicht mehr mit der Zuschreibung einfacher, verdinglichender Worte auskommen können, wenn wir Fremd- und Selbstbeobachtungen sinnvoll integrieren wollen.
Das dritte Beispiel zeigt, dass die zweite Logik auch einen Sonderfall von Metalösung aufweisen kann, wenn wir aus den althergebrachten Bahnen unserer Psycho-Logik aussteigen und etwas ganz Neues (Revolutionäres) versuchen.
Was folgt aus diesen Überlegungen? Zunächst einmal muss ich gestehen, dass ich mit dieser Einführung in die Ebene der Beziehungswirklichkeit all jene Begriffe nicht eingeführt habe, die man in Lexika nachschlagen kann, die die Enzyklopädien füllen und sich dort unter Stichworten wie Mensch, Anthropologie, Wissen, Wahrheit usw. nachlesen und nacharbeiten lassen. Mein Ansatz ist es vielmehr zu zeigen, dass selbst dann oder gerade immer dann, wenn wir mit Begriffen operieren, die unsere Beobachtungen verobjektivieren – also immer dann, wenn wir in der Form sprechen: „Das ist ein Kind, das“, „Dieser Mensch zeigt, dass“, „Ein wahres Wissen ist“ usw., – dass wir immer dann uns als erstes daran erinnern müssen, dass unsere Beobachterposition bereits begrifflich erstarrt und gedanklich auf eine engere symbolische Beobachtungslogik verkürzt worden ist. Oder sehen wir hinter die Kulissen, wo unsichtbare Verflechtungszusammenhänge zwischen den Individuen sie in ihren Interaktionen aneinander binden, ablösen, unterscheiden? Können wir überhaupt die damit verbundenen Interdependenzketten rekonstruieren?
Wir brauchen uns bloß die Rekonstruktion unserer eigenen Familiengeschichte vorzustellen, um schnell an die Grenzen der Komplexität zu stoßen. Ja, es gelingt uns nicht einmal, die eigene Situation früher Kindheit und Jugend so zu rekonstruieren, wie sie dem Grunde nach war. Und wer sollte auch von welcher Beobachterposition aus eindeutig festlegen können, wie sie nun wirklich war, wenn sie schon durch die eigenen, subjektiv unterschiedlichen Beobachterpositionen unterschiedlich nach einzelnen Beobachtungen, Teilnahmen und Aktionen wahrgenommen wurde?
Diesen Wechsel der Beobachterpositionen (unter Einschluss von Teilnahmen und Akteursrollen) möchte ich im Blick auf das Verhalten der Menschen unter- und gegeneinander als systemische Interdependenz bezeichnen. Damit wird in der Sprache der Beziehungs- oder Psycho-Logik ausgedrückt, dass das Verhalten sich nie ganz allein aus einer Person, genauer der Beobachtung einer Person, erschließen lässt, weil diese Person bereits in den Rahmen ihrer Interaktionen mit a/Anderen eingefangen ist. Ein Selbst, so können wir auch sagen, ist ohne den a/Anderen, auf den es sich bezieht, gar nicht formulierbar. Dies ist die fundamentale Voraussetzung einer Beobachterposition, die sich psychologisch nennt. In dieser sind alle wissenschaftlichen Einführungen bereits dort problematisch, wo sie bestimmte Begriffe einführen, die uns sagen lassen, dass dieser Gegenstand so oder so ist. Definitionen wie „ein guter Mensch ist“, „Wissen ist ein Vorgang, der“, „wahre Erkenntnis stellt sich dar in Stufen, die“, usw., sind zwar wohlgemeinte Hilfen für vermeintliche Anfänger im Wissen um menschliche Logik, aber sie machen zugleich hilflos, weil sie den Hintergrund der Interdependenz verschweigen und als Rückfall in eine zu enge Logik sogar irreführend sind. Sie könnten dem Beobachter suggerieren, dass es an geheimen Orten des Wissens Ratgeber oder Personen gibt, die verraten könnten, was ein wahres Wissen über Beziehungen vollständig sein müsse, wie das Lernen perfekt organisiert werde, wie eine normale Kindheitsentwicklung auszusehen habe und wer dafür verantwortlich sein sollte, vielleicht sogar, wer dafür sorgen sollte, dass dies alles kontrolliert geschieht.
Eigentlich weiß jeder aus eigener Lebenserfahrung, dass dies heute nicht mehr geht. Bei manchen ist es daher eine Projektion auf die Universität, dass sie dies doch leisten solle, weil die eigene Unsicherheit im Verhalten Anderen gegenüber zu groß ist. Für sie muss es daher zur Enttäuschung geraten, zu erkennen, dass der Beginn des Studiums das Eingeständnis des Unwissens im Blick auf die enge Definition eines wohl operationalisierbaren Verhaltens ist. Wer die beglückende Enge einer sicheren Logik mit eindeutiger Verhaltensanordnung erwartet, der wird es bei der Vernetzung des Wissens heute immer schwerer haben, sein „sicheres“ Fach zu finden. Die Verhaltens- bzw. Humanwissenschaften erweisen sich nicht als das einfachste, sondern anspruchsvollste Studium, sowohl was die Unendlichkeit der Aufgabe als auch die investierbare Zeit in das Erlernen unterschiedlicher Beobachterpositionen betrifft. Sie sind interdisziplinär, weil die Beziehungs- oder Psycho-Logik gebietet, weit über den engeren Fachzusammenhang hinaus auf jene anderen Verhaltensfächer wie Psychologie, Soziologie, Philosophie, Pädagogik, Sozial- und Kulturgeschichte, Humanbiologie, Ethnologie und andere mehr zu blicken, weil nur so das interdependente Spektrum eines interpretierbaren Verhaltens in seiner Vernetzung beobachtet und entwickelt werden kann.
Das Spiel der Gefangenen erfolgte zirkulär. Nur aus dem Verhalten der a/Anderen können sie systemisch auf die Wahrheit ihrer Farbe schließen, nur im Vergleich mit a/Anderen überhaupt zu dieser Wahrheit gelangen. Damit haben wir ein einfaches Schema menschlicher Beziehungen, das auch außerhalb des engen Gefängnisses jenes Maß an Gefangenschaft illustriert, das Menschsein bedeutet: Zirkulär mit anderen Menschen verwoben zu sein und nur in dieser Verwickeltheit so etwas wie Wahrheit – und die vielen anderen Dinge des Lebens – situieren zu können. Der Ort, an dem dies beobachtbar und in dem dies agiert und teilnehmend erlebt wird, heißt Beziehungswirklichkeit. Die Regeln, nach denen wir diese Beziehungswirklichkeit beobachten können, unterscheiden sich von den klassischen kausalen Gefangenschaften, die wir empirisch im ersten Gefangenendilemma konstatierten:
- die Regeln sind immer schon (vorstellend, sprachlich, handelnd usw.) mit den a/Anderen verbunden, von denen ich mich unterscheide und über die ich spreche;
- sie sind damit zirkulär, und die vorgestellte Linearität und Kausalität der engeren Beobachtungswirklichkeit ist ein Versuch, die darin liegende Unschärfe zu verdinglichen, zu monologisieren, zu reduzieren, indem sie entsubjektiviert werden, um Überblick, Eindeutigkeit und Wissenschaftlichkeit zu erhalten;
- diese Erhaltung aber erzwingt in ihrer Reduktivität eine Pseudowelt des wahren Wissens, das sich der eigenen Unschärfe beraubt hat und damit neue Bereiche der Unschärfe systematisch produzieren wird: Gegensätze etwa zwischen Theorie und Praxis, Wissenschaft und Alltag, Objektivierung und Subjektivität usw.
Eine wissenschaftliche Erfassung der Beziehungswirklichkeit jenseits solcher Reduktionen wird zum Problem einer Öffnung der Beobachtungen, aber Wissenschaftler betonen dann schnell die Gefahr, dass sie so in ihrer eigenen Unschärfe ertrinken könnten.
1.4. Beispiele aus empirischen Untersuchungen oder: zur Verflüssigung
unseres Forschens
Wenn ich das Beispiel der drei gefesselten Gefangenen wieder aufnehme und auf bisherige Forschungen in den Verhaltenswissenschaften übertrage, dann fällt auf, wie strikt sich die meisten Forscher an die von mir festgestellten Bedingungen halten. Fesselung meint bei ihnen:
- den Versuchsobjekten wird eine klar bestimmte, auf Eindeutigkeit der Handlung bezogene, weil nur so messbare Rolle zugewiesen;
- die Komplexität von Wirkungen aus der Umwelt oder zu starken Interaktionen mit anderen Versuchsobjekten oder den Versuchsleitern wird möglichst ausgeschlossen, was durch künstliche Laborbedingungen besonders effektiv geschieht;
- es wird immer nur das beobachtet, was in den Erwartungshorizont fällt;
- es gibt eine Fiktion über die Wertfreiheit der angestellten Beobachtungen.11
Zwar sind solche Untersuchungen nicht prinzipiell ungeeignet,12 sie sind auch interessant, um die Entwicklung der Verhaltensforschung von heute aus nachzuzeichnen, aber sie leiden am Mangel zu starker Reduktion, sie beachten in der Regel zu wenig die für Menschen wichtigen Prozesse der Interaktion und Kommunikation mit ihrer Interdependenz, mit der Verflechtung von Handlungsketten, mit der Dynamik von Entwicklungen und Veränderungen, mit willentlichen Prozessen, die nicht so determiniert sind, wie sie einem flüchtigen Beobachter vielleicht erscheinen. Zunächst will ich zwei Beispiele aus dieser Logik herausgreifen, um sowohl Schwächen als auch mögliche Stärken dieser Art von Betrachtung exemplarisch herauszustellen.
1.4.1. Verhaltenswissenschaften als Ausdruck enger Beobachtungslogik
a) Der kleine Albert oder der Mensch als Ratte
John Watson, der als einer der wesentlichen Begründer des Behaviorismus gilt, konnte auf der Forschung Pawlows aufbauen, der 1905 ein klassisches Experiment durchführte. Pawlow stellte einen Hund in einen besonderen Apparat, eine spezifische Fesselungsbedingung also, in dem er sich kaum bewegen konnte. In einem Auffangbehälter wurde der Speichel des Tieres gesammelt. Pawlow konnte ihm nun Futter geben und dazu bestimmte Reize wie Licht, Summtöne usw. einsetzen. Ertönte zu Beginn des Experiments eine Glocke, so ergab sich keine Speichelreaktion. Wurde aber die Futtergabe mit Glockentönen verbunden, so stellte sich alsbald bereits beim Klang der Glocke Speichelfluss ein. Der Hund konnte konditioniert werden. Die Glocke, ein zunächst neutraler Reiz, wurde als bedingter Reiz bezeichnet. Das Futter hingegen stellte einen unbedingten Reiz dar. Unbedingt meint hier, dass der Organismus gar nicht anders reagieren kann, weil er angeborenerweise eine reflexhafte Antwort auf solche Reize hervorbringt. Später ist Skinner insbesondere durch seine Rattenversuche bezüglich der Erforschung solcher Reize berühmt geworden. Übertragungen solcher Versuche auf Menschen boten sich als einfachste Erklärung an: Auch Menschen unterliegen Reizen. Wenn sie nun im Laufe ihres Lebens bestimmte unbedingte Reize mit bestimmten bedingten verknüpfen, also konditioniert lernen, dann schien sich daraus jegliches erlernte Verhalten vollständig erklären zu lassen. Besonders Watsons Versuch mit dem kleinen Albert wurde in dieser Hinsicht zum Prototyp einer Forschung, die durch Reduktion der Umweltbedingungen die einfachste Lösung der Verhaltenserklärung hervorbringen will. Bevor ich auf das Experiment eingehe, will ich eine Gegenseite zu diesem Experiment schildern.
Watsons Experiment war in gewisser Hinsicht eine Antwort auf Freuds Psychoanalyse. Freud hatte zahlreiche psychische Phänomene in Fallbeispielen beschrieben, wobei er sowohl die innerpsychischen Vorgänge des jeweils betroffenen Individuums als auch insbesondere die spezifische Interaktion in der Familie, hier vor allem im Blick auf die Entwicklung in der Kindheit, in ihrer Bedeutung für die individuelle Psyche hervorhob. Eines dieser Fallbeispiele, das Freud brieflich analysierte, war der kleine Hans. Hans hatte eine phobische Angst vor Pferden. Obwohl der Vater von Hans, der der Psychoanalyse nahe stand, versuchte, seinen Sohn nicht mit dem üblichen Zwang seiner Zeit zu erziehen, bekam Hans im Alter von fünf Jahren Angst vor Pferden. Er hatte Angst, dass ein Pferd ihn beißen könnte und weigerte sich, aus dem Haus zu gehen. In seiner Analyse stellte Freud eigentümliche Gemeinsamkeiten zwischen dem Vater und den Pferden fest. Hans hatte in seinen fantasievollen Äußerungen öfter Verbindungen zwischen Vater und Pferd hergestellt, ohne sich selbst dieser Verbindung bewusst werden zu können. Hierin interpretierte Freud den ödipalen Konflikt des Knaben. Er fühlte sich zu seiner Mutter hingezogen und war, ohne sich dies eingestehen zu können, eifersüchtig auf den Vater. Da dieser jedoch bedrohlich größer und mächtiger als er war, zugleich auch ein Objekt der Identifikation darstellte, musste er seine feindseligen Gefühle gegen den Vater abwehren, was er durch die Übertragung auf die Pferde für sich löste. Mit dem Untergang des ödipalen Konfliktes überwand Hans später schließlich seine Angst. Für Freud hätte es wenig Sinn gemacht, konditionierend an dem Verhalten des Knaben herumzumanipulieren, er suchte vielmehr eine innerpsychische Erklärung für dieses Verhalten, um Vater und Sohn eine Dramatisierung zu ersparen und ein mögliches therapeutisches Eingehen auf den Konflikt zu ermöglichen. Eine Phobie eines Kindes wurde von Freud auf unbewusste Konflikte und deren Verschiebung hin auf ein Krankheitsbild zurückgeführt.
Watson nun hatte etwas gegen die Freudsche Erklärung. Sie war ihm zu kompliziert und setzte voraus, einen empirisch gar nicht direkt beobachtbaren ödipalen Konflikt als schwer beweisbare Vorannahme zu unterstellen. Konnte eine Phobie nicht viel einfacher erklärt werden?
Als Versuchsobjekt diente Watson und seiner Kollegin Rayner der kleine Albert. Er wurde im Alter von 11 Monaten dadurch konditioniert, dass die Versuchsleiter mit einem Hammer auf ein Stahlrohr schlugen. Der Kleine war sichtlich erschrocken. Nach einigen Schlägen begann er zu weinen. Ein unbedingter Reiz war gefunden. Albert hatte vor dem Experiment Kontakt zu einer weißen Versuchsratte gehabt, die ihn sehr interessierte. Er zeigte keinerlei Angst. Im Experiment wurde nun Albert die Ratte wieder gezeigt und dies dann von lauten Geräuschen begleitet. Albert bekam Angst. Als er später wieder die Ratte ohne Geräusch gezeigt bekam, hatte er immer noch Angst. Watson und Rayner meinten, dass sie in Albert durch bloße Konditionierung eine Phobie gegenüber Ratten erzeugt hätten. Sie versuchten dann noch, diese Angst auf andere Gegenstände der Umgebung Alberts auszuweiten, was in der Regel gelang. Albert zeigte sich allerdings unempfindlich gegenüber allen Reizen, wenn er am Daumen lutschte.
Dieses Experiment wurde zum Auslöser für zahlreiche bis heute andauernde Forschungen zur Konditionierung menschlichen Verhaltens, die zugleich zur Machtfantasie der Behavioristen gerieten. Watson und Skinner etwa glaubten, dass sie mittels Konditionierung die gesamte Menschheit zu beliebigen Spezialisten und Persönlichkeiten konditionieren könnten – besonders illustriert in Skinners Roman „Walden two“ (übersetzt als „Futurum 2“).
Der Umgang mit dem Fall Albert hat in der Forschung unglaubliche Blüten hervorgebracht. „Ein Psychologie-Lehrbuch aus jüngster Zeit beschreibt detailliert, wie Albert seine Phobie verliert, nachdem er Schokolade als Belohnung dafür erhält, dass er die Ratte näher und näher an sich heranlassen kann! Offenbar mochten die Autoren einfach nicht glauben, dass Watson und Rayner Albert ohne jegliche Behandlung nach Hause entließen – doch genau das haben sie getan.“ (Schwartz 1991, S. 59)
An diesem Experiment fällt das in konkreter Weise auf, was ich weiter oben als Bedingungen einer engen Beobachtungslogik herausgestellt habe:
- Albert wurde im symbolischen Sinne gefesselt, d.h. seinen Handlungsmöglichkeiten wurde durch die Anordnung des Experimentes eine klare, eindeutige und präzise zu beobachtende Rolle zugewiesen. Albert wurde als Objekt eines Forschungsprozesses gebraucht. Es war den Versuchsleitern offensichtlich auch gleichgültig, ob er – wenn denn ihre Behauptung stimmen würde – mit einer Phobie nach Hause geht, denn die erzeugte Angst wurde durch die Versuche selbst nicht aufgelöst.
- Eine Komplexität von Umweltwirkungen oder zu starken Interaktionen mit anderen Versuchsobjekten oder den Versuchsleitern wurde in dem Experiment möglichst ausgeschlossen, d.h. hier durch eine künstliche Laborbedingung begrenzt. Es kam nicht darauf an, Albert in seiner natürlichen Umgebung zu beobachten, sondern Verhaltensaspekte zu isolieren, um möglichst einfache Antworten zu finden.
- Watson und Rayner beobachteten nur das, was in ihr vorgedachtes Modell passte. Dabei schrieben sie dem ängstlichen Verhalten Alberts eine phobische Reaktion zu, die überhaupt nicht konstant und aus dem Icherleben des Kindes über längere Zeit nachweisbar war. Besonders problematisch war die Kurzzeitbeobachtung, die den meisten behavioristischen Versuchen späterer Zeit auch als Makel anhaftete. Nur in den Imaginationen der Behavioristen ließen sich Langzeiterfolge feststellen.
- Die behavioristische Methode selbst wurde überbewertet, weil sie den einfachsten und damit vermeintlich einleuchtendsten Erklärungsversuch darstellte. Hier wird wie in der Technik geschlussfolgert, dass die simpelste Erklärung wohl immer die beste sein müsse. Die Anordnung des Experiments schließt subjektivistische Bedeutungen scheinbar aus, so dass ein wertfreier, d.h. im engeren Sinne wissenschaftlicher Behauptungszusammenhang erreicht wird.
b) Das Milgram-Experiment
Solomon Asch hat verschiedene sozialpsychologische Experimente durchgeführt, von denen das Konformitäts-Experiment eines seiner bekanntesten ist. Hier wird eine Versuchsperson in eine Gruppe anderer Versuchspersonen integriert, ohne zu wissen, dass diese in das Experiment eingeweiht sind. Dann sollen physikalisch eindeutige Zusammenhänge, wie etwa die Länge von Linien bestimmt werden. Zunächst stimmen alle überein. Dann jedoch kommt es dazu, dass die Wahrnehmung aller anderen Personen anders als die von unserer Versuchsperson ist. Obwohl sie die physikalische Realität eigentlich anders sieht, gibt sie daraufhin sehr oft in den Versuchen dem sozialen Druck nach und entscheidet sich dafür, was die Anderen auch sagen. Der Konformitätsdruck wächst mit der Anzahl der Gruppenmitglieder. Asch konnte zeigen, dass hierfür in der Regel schon die Mehrheit von drei Gruppenmitgliedern ausreichend ist, um einen hinreichend hohen sozialen Druck auf die Versuchsperson auszuüben.13
Stanley Milgram lieferte nun eines der berühmtesten sozialpsychologischen Experimente, in dem er die Konformität von Versuchspersonen gegenüber Autoritäten untersuchte. Sein klassisches Experiment soll kurz skizziert werden:
Mittels Zeitungsanzeigen suchte Milgram Versuchspersonen, die in der angesehenen Yale-Universität an einem Experiment über „Gedächtnis und Lernen“ teilnehmen wollten. Dort werden sie in ein Labor geführt und es wird scheinbar ausgelost, ob sie Schüler oder Lehrer werden. Alle Versuchspersonen werden Lehrer. Dann sollen sie dem Schüler bestimmte Wortverbindungen beibringen, wobei dieser im Nebenraum getrennt sitzt, sie aber seine Stimme hören können. Wenn er etwas Falsches sagt, soll er kleinere Elektroschocks bekommen. Vorher wurde dem Lehrer mittels eines kleinen Schocks gezeigt, dass der Apparat auch tatsächlich funktioniert. Mit der Zeit häufen sich die Fehler des Schülers und die Elektroschocks werden immer höher angesetzt. Bei 75 Volt stöhnt der Schüler laut auf. Ebenso bei 90 und 105 Volt. Bei 120 sagt er, dass es schmerzt. Bei 150 Volt will er aus dem Experiment entlassen werden. Bei 300 Volt hört man noch ein Klopfen an der Wand, nach 330 Volt nichts mehr. Auf Zweifeln des Lehrers erklärt ihm der Versuchsleiter bei jeder Voltsteigerung, dass er weitermachen müsse, wenn er das Experiment nicht gefährden wolle. Der Versuchsleiter wirkt streng und förmlich, er repräsentiert die Nüchternheit der wissenschaftlichen Logik, die dem Experiment zugrunde zu liegen scheint. So werden Schocks bis in lebensbedrohliche Größen gegeben.
In einer Voruntersuchung hatte Milgram in einem Seminar Teilnehmer gefragt, wie lange sie wohl bei dem Experiment teilgenommen hätten. Die Vermutungen gingen dahin, dass spätestens bei 120 bis 135 Volt Schluss mit dem Experiment sein werde.
In der tatsächlichen Untersuchung aber zeigte sich, dass mehr als 60 % der Versuchspersonen dem Versuchsleiter gehorchten und Schocks bis zu 450 Volt verabreichten. Bei Variationen des Experiments stellte sich heraus, dass die Maximalschocks abnahmen, wenn der Lehrer den Schüler direkt berühren konnte, zunahmen, wenn er räumlich getrennt war.
Entscheidend im Blick auf den Gehorsam war die Frage, wie viele Versuchspersonen sich dem Versuch überhaupt widersetzten. „35 Prozent der Versuchspersonen widersetzten sich dem Versuchsleiter bei der Fernraum-Anordnung, 37,5 Prozent bei der akustischen Rückkopplung, 60 Prozent im Raumnähe-Versuch und 70 Prozent bei der Berührungsnähe.“ (Milgram 1982, S. 52 f.) Maximalschocks, in denen der Schüler nach heftigem und dramatischem Schreien – es handelte sich in den Experimenten um gut einstudierte Schauspielleistungen – keinen Laut mehr von sich gab, wurden dabei in einer Atmosphäre produziert, die für die Versuchspersonen oft von einem heftigen Konflikt begleitet wurde. Eine große Zahl der Versuchspersonen wurde durch den herbeigeführten Konflikt, den sie im Sinne des Gehorsams lösten, von Zweifeln geplagt, so dass es zu großer Nervosität, zum Stottern, zu Übersprunghandlungen kam. Sie standen vor der Wahl, entweder dem Schüler, der um Abbruch flehte, nachzugeben, oder den strengen Werten einer Wissenschaft zu folgen, die versprach, dass dem Schüler kein bleibender Schaden zugefügt werde.14 Widerstand gegen die Autorität konnte nur von jemandem erbracht werden, der die Verantwortung für sein eigenes Tun aktiv zu verteidigen suchte. Ganz gleich, was die Wissenschaft sagte, diesen Menschen musste unerträglich sein, das zu tun, was man von ihnen verlangte.
Auch in diesem Experiment sind die Regeln enger Beobachtungslogik eingehalten:
- Der vermeintliche Schüler wurde real gefesselt und die Versuchspersonen in eine Situation gestellt, die ihnen eine klare, eindeutige und präzise zu beobachtende Handlungsrolle zuwiesen. Die Versuchspersonen wurden als Objekt eines Forschungsprozesses gebraucht. Es war den Versuchsleitern allerdings hier nicht gleichgültig, wie sie mit den Ergebnissen umgingen. Sie wurden über das Experiment später aufgeklärt, was bei etlichen zu einem Überdenken der eigenen Haltung führte. An dieser Stelle verließ das Experiment den klassischen Versuchsrahmen und ging in eine Art teilnehmende Beobachtungsinterpretation über.
- Die Komplexität wurde auch hier durch eine künstliche Laborbedingung begrenzt. Es kam nicht darauf an, die Versuchspersonen in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten, sondern Verhaltensaspekte zu isolieren, um möglichst einfache Antworten zu finden.
- Auch Milgram beobachtete nur das, was in sein vorgedachtes Modell passte. Seine recht einfache Erklärung lautete, dass es sich bei den Handlungen um einen Gehorsam handelt, der von jemandem, der in der sozialen Hierarchie höher steht, veranlasst wird. Andere Positionen werden kategorisch ausgeschlossen.
- Die experimentelle Methode wurde auch hier wie im Beispiel der Behavioristen überbewertet. Die Anordnung des Experiments schließt subjektivistische Bedeutungen scheinbar aus, vermeintlich wird Wertfreiheit erzielt. Allerdings zeigt die Konsequenz des Experiments eben auch die Gefahren dieses engeren Modells auf.
Weil das Milgram-Experiment diese Gefahren so offensichtlich werden lässt, können wir aus der Analyse einen großen Gewinn ziehen. Im Gegensatz zum kleinen Albert ist es nicht banal angeordnet und naiv durchgeführt, sondern bezieht sich durchaus in seiner Künstlichkeit auf einen gesellschaftlichen Realitätsbereich, wie er besonders dem Militär zu eigen ist, aber auch von der breiten Masse gegenüber Institutionen wie Gerichten oder Universitäten usw. empfunden wird – auch wenn in der Post-Moderne diese Tendenz abnimmt. Auf der Basis eines konformen Urteils, das gesellschaftlich nicht in Zweifel steht, ließen sich Menschen zu Handlungen verleiten, deren Wirkungen sie teilweise mit großem Konflikt verarbeiteten, die sie aber nicht zum Widerstand brachten. Jene, die Widerstand übten, werden von Milgram in ihren Äußerungen beschrieben, aber er gibt keine Erklärung dafür, wie sie dazu geworden sind. Dies übersteigt den Aussagerahmen des Experimentes. So kommt das Experiment zu einem einfachen Ergebnis: Irgendwann müssen die Nachforschungen darüber, warum ich etwas tun soll, abgebrochen werden, wenn ich es tun soll. Hier zeigen wir uns als Teilnehmer einer hoch arbeitsteiligen, funktionalistisch organisierten und hierarchisch strukturierten, wenngleich hochgradig verflochtenen Gesellschaft als Gefangene einer Logik erster Ordnung, die uns kausal mitteilt, was zu tun ist. Als Akteur und Beobachter begrenzt uns diese Teilnahme, die uns deterministisch umschreibt, was wir zu tun und zu lassen haben, die uns belohnt oder bestraft, weil wir als Gefangene des gesellschaftlichen Systems nur dann adäquat funktionieren, wenn wir uns nach den konformen Regeln verhalten, die den Verhaltensspielraum in der modernen Zivilisation angeben. Norbert Elias beschreibt die Zunahme an Freiheit westlicher Gesellschaften der Neuzeit deshalb auch als eine Folge der Zunahme von Selbstzwängen gegenüber Fremdzwängen früherer Zeiten. Wo früher noch direkt gedroht und gestraft werden musste, um gesellschaftlich konformes, meist unterdrücktes Verhalten zu erzwingen, da legen die modernen, demokratieorientierten Gesellschaften Wert auf eine Sozialisation, die Selbstzwänge produziert, so dass jeder Gesellschaftsteilnehmer genügend rationalisierte und psychologisierte Langsicht entwickelt, sich im Rahmen der zugelassenen Spielregeln zu verhalten. Die erzeugte Gefangenschaft wird in einer Umdeutung oft gerne als Freiheit idealisiert, weil die Selbstfindung den zugleich erworbenen Zwang übersehen lässt. So wird der komplizierte Hintergrund solcher Freiheit übersehen und der Selbstzwang rationalisiert.
Was aber heißt Rationalisierung überhaupt in diesem Fall? Rationalisierung bedeutet hier, dass man genügend Vernunftargumente für die eine oder andere Seite findet. Gerade hier ist das Milgram-Experiment äußerst instruktiv. Es beschreibt, dass die Versuchspersonen z.B. im Dienste der Wissenschaft, einer Verbesserung des Lernens und der Leistung, im Blick auf die Angesehenheit der Universität, der unterstellten Integrität des Versuchsleiters, der Entscheidung eines Handlungsdilemmas im Sinne der Konformität bereit waren, auch gegen eigene Gefühle zu handeln und sich dies am Ende sprachlich noch als richtig zu suggerieren, indem sie den Schmerz verharmlosten und den Erfolg der Untersuchung priesen, obwohl sie diese selbst gar nicht durchschauten. Eine solcherart hergestellte Langsicht, die auf undurchschauten und zum Teil auch undurchschaubaren rationalen Argumenten gründet, ist mittlerweile typisch für moderne Industriegesellschaften geworden, wo kaum mehr Informationen aus erster Hand gewonnen werden können. Als Zeitungsleser oder Fernsehzuschauer sind wir oft in der Position der Milgram-Versuchspersonen, nur dass wir keine Elektroschocks verabreichen, sondern aus den vorgelegten Konstrukten uns Urteile gewinnen, die rationalisierte Verallgemeinerungen darstellen. Je konformer diese Verallgemeinerungen werden, desto heikler können sie werden, wie die Massenbewegungen des 20. Jahrhunderts etwa in ihren Ausprägungen Nationalsozialismus oder Stalinismus in erschreckender Weise zeigten.
Aber auch eine Psychologisierung ist erkennbar. Die aufgewühlte Seele, die im Experiment körperlich spürbar nervös wurde, muss sich beruhigen können. Einerseits besteht sie auf einem zunehmenden Bemerken eigener Gefühlswelten, andererseits auf einer Distanzierung. Je mehr die Versuchspersonen in direkte Berührung mit dem Schüler kamen, desto geringer wurde die Bereitschaft, ihn zu quälen – zumindest bei 70 Prozent der Versuchspersonen. Andererseits lässt sich durch andere Untersuchungen zeigen, dass die Bereitschaft, Anderen zu helfen, deutlich in der modernen Kultur dann abnimmt, wenn auch Andere helfen könnten. So etwa haben John Darley und Bibb Latané (1970) festgestellt, dass je mehr Menschen einem Ereignis zusehen, sie desto weniger direkt und persönlich verantwortlich einem in Not geratenen Menschen helfen. Hier ist es sehr von der sozialen Wahrnehmung in Wechselwirkung mit anderen Menschen abhängig, ob und wie geholfen wird. Es gehört zur ausgeprägten Psychologisierung unserer Kultur, dass wir eigene Gefühle beachten, aber die Gefühle einer bedrohten Person dadurch abwehren, dass wir uns bei möglicher Hilfe selbst in Gefahr sehen. Und dies auch dann, wenn eine Masse von Personen einem einzigen Angreifer gegenübersteht. Hier gibt es hinreichend Beschreibungen über reale Ereignisse – ein uns besonders vertrautes Ereignis sind die Gaffer nach Unfällen –, die eine Quasinorm der Gleichgültigkeit erzwingen und zugleich zu einer bestimmten Konformität der Handlungen im Sinne einer abstrakten Menschenliebe aufrufen. Solche psychologisierten Quasinormen sind auch im Milgram-Experiment zu beobachten. Gegenüber der Wissenschaft, ausgedrückt in dem Versuchsleiter, will man sich nicht blamieren, nicht kindlich wirken, weil man die Aufgabe nicht begriffen hat, nicht versagen, weil ja mehr als die eigene Sichtweise auf dem Spiel steht usw. Nur bei sehr hohem Selbstzwang ist daher das brutale Verhalten der Versuchspersonen zu verstehen, die sich dabei einem körperlichen Stress aussetzten, der bis zum Nervenzusammenbruch reichen konnte. Solcherlei Symptombildung zeigt die Gewalt der widersprüchlichen Anordnungen nach eigenen intimen Verhaltensmustern und öffentlich erwartetem Verhalten.
Damit aber sind wir auf eine neue Blickrichtung gegenüber dem Experiment gestoßen. Es funktionierte im Sinne des Gehorsams ja nicht in einer faschistischen Gesellschaft, nicht in Kriegs- oder Notsituationen, sondern in vermeintlicher Freiheit einer Demokratie. Jeder konnte ohne Furcht vor Strafe nein sagen. Aber die Strafandrohung liegt tiefer, sie ist viel subtiler, als es der Versuch selbst darstellen kann oder Milgram dargestellt hat.
1.4.2. Verhaltenswissenschaften als Ausdruck einer Beziehungslogik
Wir selbst können uns in eine Beobachterposition setzen und das kritisch hinterfragen, was Andere in ihrer engen Beobachtungslogik beobachteten. Aus unseren anderen Blickwinkeln ergeben sich damit neue Zusammenhänge, die die Bedingungen der Fesselung psychischer Prozesse an die Logik einer Verdinglichung auflösen können. Das Milgram-Experiment wies dahin gehend übrigens schon etliche Bestandteile auf: So etwa in der relativen Freiheit der Versuchspersonen, die sich als selbstbeobachtende Teilnehmer aus dem Geschehen durch Widerstand lösen konnten; aber auch durch die Nachbesprechungen, in denen auf einmal neue Blickwinkel gegenüber dem Experiment möglich waren. Gerade wegen dieser Annäherung an die komplexeren Bedingungen menschlichen Lebens beeindruckt uns das Experiment, und wir ziehen von unserer Beobachterposition aus Gewinn aus der Untersuchung, weil wir darin mehr entdecken können als die Reduzierung und Isolierung eines einzigen Phänomens (wie z.B. der Konditionierung), das dann bloß noch künstlich wirkt.
Es ist eine wesentliche Bemerkung, dass wir – ein jeder von uns unterschiedlich – selbst in der Beobachterrolle eine Verschiebung der Blick- und Interpretationsrichtungen herbeiführen können. Wir sind durch unsere imaginären und symbolischen Bewegungen in der Lage, immer neue Sichtweisen auszuschöpfen und so ein recht starres System von Zuschreibungen, tradierten Regeln und überlieferten Normen immer neu auf seine vermeintlich objektive Geltung hin kritisch zu befragen. Dabei ergeben sich recht eigentümliche Erkenntnisse, wenn wir an den anscheinend sicheren Orten der Normalität nachforschen. Einer dieser Nachforschungen, die sich bewusst der Beziehungs- oder Psycho-Logik zu stellen versuchte, will ich exemplarisch nachgehen.
Das Rosenhan-Experiment
Stellen wir uns vor, dass wir dafür im Rahmen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung verantwortlich sind, zwischen normalen oder gesunden und anormalen oder irren Personen zu unterscheiden. Wir haben dies studiert, wobei wir allerdings herausfinden mussten, dass solche Unterscheidungen äußerst schwierig sind. Immerhin hat man uns im Sinne eindeutiger Wissenschaftsorientierung an der Universität beigebracht, dass bei den nicht normalen Patienten etwas mit der Wirklichkeitsanpassung nicht stimmt. Dafür haben wir bestimmte Klassifikationen erlernt. Durch neuere vergleichende Arbeiten sind wir allerdings schon vorsichtig geworden, dass solche Klassifizierungen in unserem Kulturkreis als richtig (wenngleich zunehmend strittig) gelten mögen, in anderen aber ganz anders empfunden werden. Aber dies ändert ja eigentlich nichts an der Tatsache, dass wir Normalität in unserer Gesellschaft als Maßstab des Verhaltens nehmen.
Nun unternahmen Rosenhan (1990) und andere folgendes Experiment. Sie wählten als normal oder gesund bekannte Personen zu einem freiwilligen Versuch aus. Sie sollten sich in einer psychiatrischen Klinik melden und behaupten, dass sie leere, hohle, dumpfe Stimmen gehört hätten. Diese erfundenen Symptome wurden gewählt, weil sie auf eine existenzielle Psychose hindeuten, für die es in der Literatur aber keinen klaren Bezug gibt. So als Scheinpatient in die Klinik aufgenommen, erwarteten die Forscher, da außer Name, Beruf und Arbeitsplatz und des vorgespiegelten Symptoms nichts weiter an der Persönlichkeit verändert wurde, bald als gesund erkannt zu werden, wenn sie überhaupt mit diesem Symptom Aufnahme finden sollten. Denn außer dem genannten Symptom am Anfang verhielten sie sich nach der Einweisung völlig „normal“.
Wenn wir an die Funktionalität von Psychiatrien glauben, dann laufen die Forscher Gefahr, schnell als Scheinpatienten erkannt und verspottet zu werden. Aber dies geschah in dem tatsächlich durchgeführten Experiment nicht. Keiner der Scheinpatienten wurde entlarvt. Von den Freiwilligen wurden die meisten als Schizophrene und einer als manisch-depressiv eingewiesen. Mindestens eine Woche bis zu zwei Monate wurden sie hospitalisiert, wobei ihre Entlassung nicht die Gesundheit diagnostizierte, sondern in Remission erfolgte. Während etliche Mitpatienten schnell den Verdacht bekamen, dass die Scheinpatienten in ihrem Sinne nicht normal, d.h. irgendwie fehl am Platze seien, beobachtete das Klinikpersonal sie kaum und nur oberflächlich. Die Diagnose der offensichtlich völlig normalen Lebensverhältnisse der Scheinpatienten wurde unter der Konstruktion der Krankheit wahrgenommen und auf dieser Basis jeweils rekonstruiert. So machten sich die Scheinpatienten beispielsweise täglich Notizen von dem, was sie beobachteten. Anfangs hatten sie Sorge, dass sie damit auffallen würden. Aber unter der Wahrnehmung der Ärzte und des Pflegepersonals wurde dies einem Tick zugeschrieben. Es wurde nicht nachgefragt, warum sie das tun. So schrieb sich ein Scheinpatient auf, welche Medikamente er einnehmen soll. Der Arzt sagte, dass er es sich nicht aufschreiben brauche, weil er ihn immer wieder fragen könne. Statt also darüber zu kommunizieren, warum etwas getan wird, wurde hier die Kommunikation darauf beschränkt, was man von „Irren“ eigentlich erwarten könne – im Grunde komische Dinge. Als ein Scheinpatient den langen Flur auf und ab ging, fragte ihn eine Schwester: „Na, sind sie nervös?“ Er antwortete: „Nein, nur gelangweilt.“ Auch hier wirkte die Konstruktion der Krankheit im Kopfe der Schwester. Statt nach möglichen äußeren Faktoren zu fragen, wird von vornherein eine innere Quelle seiner Verwirrtheit unterstellt, was ihn dann auch entsprechend dieser Konstruktion beobachtbar werden lässt.
Geisteskranke gelten in der Öffentlichkeit als unberechenbar und in gewisser Hinsicht auch nicht als heilbar, denn man kann ja nie wissen, ob es nicht wieder zum Ausbruch der Krankheit kommt. Solche oberflächlichen Betrachtungen konnten die Scheinpatienten auch beim Fachpersonal, den Ärzten, Psychologen, Schwestern, Krankenpflegern und Sozialarbeitern feststellen. Personal und Patienten sind streng getrennt. Es gibt Berührungsängste, die wieder auf spezifische Fesselungsbedingungen hinweisen. Dabei sind die Arbeitsräume des Fachpersonals von den Patienten mittels Glas abgetrennt, wobei die Zeit, die das Personal außerhalb seines Käfigs mit den Patienten verbringt, als erschreckend gering angesehen werden muss. Nach den Berechnungen der Scheinpatienten verbrachten Pfleger etwa 11,3 % ihrer Zeit (Schwankungen von 3 bis 52 %) außerhalb des Käfigs, der sie vor den Patienten schützte. Die Schwestern nahmen sich noch weniger Zeit. Da diese sehr schwer zu berechnen war, stellten die Scheinpatienten die Häufigkeit fest, in der sie den Käfig verließen: Etwa 11,5 mal pro Tagschicht (Schwankungsbereich von 4 bis 39 mal). Ärzte waren noch weniger anwesend. Sie tauchten etwa 6,7mal pro Tag auf (Schwankung 1 bis 17 mal), waren insgesamt als die qualifiziertesten Beobachter aber am wenigsten mit den Patienten zusammen (vgl. ebd., 125). Für die Scheinpatienten betrug die durchschnittliche Tageszuwendung 6,8 Minuten. Dabei sind in den Durchschnitt aber das längere Einweisungsgespräch, die Stationstreffen, Einzel- und Gruppentherapien, Treffen, in denen Fälle vorgestellt wurden und das Entlassungsgespräch eingerechnet (ebd., 131 f.).
Die Scheinpatienten erlebten viele Momente der Entpersönlichung. Sie erlebten auch die ganze Hilflosigkeit der Psychiatrie gegenüber ihren Symptomen. „Alles in allem erhielten die Scheinpatienten fast 2 100 Tabletten, einschließlich Elavil, Stelazin, Compazin und Thorazin, um nur einige zu nennen.“ (Ebd., 130) Allein diese Vielfalt an gegensätzlichen Medikamenten bei gleicher Symptomatik zeigt die ganze Ungeheuerlichkeit einer Konstruktion, die Krankheit als ein Versuch- und Irrtum-System verwaltet. Die Scheinpatienten hatten allerdings Gelegenheiten gefunden, die Tabletten verschwinden zu lassen. Auf den Toiletten bemerkten sie, dass andere Patienten ihnen gleichtaten. So lange man kooperierte, war dies offensichtlich kein Problem.
Ziehen wir eine Schlussfolgerung aus dem Experiment, dann ergibt sich der ernüchternde Zusammenhang, dass die besuchten 12 Kliniken offenkundig nicht Gesunde von Geisteskranken unterscheiden konnten. Als man einer besonders angesehenen Klinik, die meinte, bei ihr könne das nicht passieren, nach den Untersuchungen mitteilte, dass einige Scheinpatienten auch bei ihr um Rat suchen werden, wurden die Mitarbeiter gebeten, nach Scheinpatienten Ausschau zu halten. Daraufhin wurden 41 Patienten von mindestens einem Mitarbeiter bei der Beurteilung von 193 Patienten für einen Scheinpatienten gehalten, obwohl gar keiner hingeschickt worden war. Auffällig war auch, dass der als einziger Scheinpatient diagnostizierte manisch-depressive in eine Privatklinik aufgenommen worden war. Die Heilungsaussichten sind bei dieser Zuschreibung erheblich besser als bei den anderen. Hier wirkte offensichtlich die Zuschreibung von Gesellschaftsschicht und Krankheitserwartung auf die Diagnose ein.
Das Rosenhan-Experiment kann zeigen, dass die Konstruktion von Wirklichkeit an bestimmte Erwartungen der Beobachter geknüpft wird und sich in Institutionen verselbstständigt. Es ließen sich weitere Experimente vorstellen, die auch in pädagogischen Institutionen zu ähnlichen Ergebnissen der Zuschreibung kommen. Es bleibt uns bei solchen Fallbeispielen und die an sie geknüpften Überlegungen die entscheidende Frage, welcher Konstruktion der Beobachter hier eigentlich erliegt. Gerade bei psychischen Abweichungen von der Norm beginnt ein großes Angst- und Abwehrverhalten, das uns im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung zu Institutionen geführt hat, die vermeintlich sicher Störungen verwalten, obwohl sie besonders im Bereich der Psycho-Logik eigentlich nicht eindeutig definieren können, was diese Störungen sind. Hier finden wir ein geradezu klassisches Beispiel dafür, dass wir nach der Logik der Technik, der Eindeutigkeit eines präzise beschreibbaren Ablaufs von Ereignissen wahr behaupten können, dass jemand gesund oder krank sei. Die einmal gesetzte kausale Urannahme eines Symptoms unserer Scheinpatienten reichte aus, daraus ein ganzes Gestrüpp weiterer Annahmen zu konstruieren, in das die tatsächliche Handlung eingebettet wurde. Aber gibt es damit überhaupt noch eine tatsächliche Handlung? Wie sollen wir je Gewissheit darüber haben, ob nicht irgendwer uns in einem ähnlichen Kausalgestrüpp verortet und uns damit Rollen zuschreibt, in denen wir uns gar nicht verstanden fühlen?
Jeder hat dies in seinem Leben bereits erlebt. Aber jeder hat auch Andere dermaßen behandelt, dass sie zum Opfer kausaler Zuschreibungen wurden. Es liegt dies an unserer Naivität, die uns Ereignisse aus der engen Beobachtungslogik, aus einer Logik, die mit Sachen, mit Gegenständen und deren physikalischer oder strikt normativer Bewegung operiert, auf das menschliche Verhalten übertragen lässt, obwohl wir es eigentlich besser wissen sollten. Denn was für Gefahren ergeben sich aus einer Beobachterposition, die sich technisch so sicher, wahrheitsmäßig zumindest wahrscheinlich sicher und gesellschaftlich zumeist anerkannt weiß?
Ich will einige Strategien und Gefahren der Anwendung einer engen Logik auf das Verhalten von Menschen zusammenfassend nennen:
- Objektivität ist ein Schlüsselbegriff wissenschaftlicher Betrachtungen. Aber Objektivität ist eine verallgemeinerte Abstraktion aus einer je subjektiven Bewegung, die für sich ein Objektives festhält und es Anderen vermittelt. In solche Geltung mischen sich sehr komplexe Verflechtungszusammenhänge und Interdependenzketten ein: Gesellschaftliche tradierte Normen und Werte, Interessenlagen von Menschen, subjektiv bedeutsame und widersprüchliche Bedürfnislagen, interaktive und kommunikative Verflechtungen zwischen Individuen, Gruppen, Nationen, die Macht der Dinge, des Gegenständlichen einer technisch produzierten Wirklichkeit und einer bedrängten Natur. Im menschlichen Verhalten haben wir es mit anderen Worten mit einem so komplexen Thema zu tun, dass insbesondere naturwissenschaftliche Reduktionen und der gesellschaftliche Druck einer exakten, oft bürokratisierten Aussage uns zu scheinbar notwendigen Verzerrungen in unseren Beobachtungen führen.
- Die daraus resultierende Komplexitätsreduktion, die dem naturwissenschaftlichen Denken der Neuzeit zu folgen sich bemüht, lässt die möglichst einfache, anschauliche und nachvollziehbare Erklärung des Beobachteten als wahrscheinlich und richtig erscheinen. Konformität ist ein wichtiger Garant für die Normierung solcher Wirklichkeitskonstruktionen. Hier ist allerdings einzuschränken, dass auch die Naturwissenschaften selbstverständlich nicht frei von den Bedingungen der Komplexität sind. Sie arbeiten methodologisch jedoch so, dass sie die Komplexität bewusster reduzieren – und dies teilweise auch erfolgreich können – als die Verhaltenswissenschaften. Jedoch zeigen gerade die Grenzfelder der Naturwissenschaften Probleme des Lebendigen: Ökologische Katastrophen z.B. sind eben auch einem naturwissenschaftlichen Weltbild zu verdanken, das blind gegenüber der Komplexität von Natur gemacht hat.
- Es handelt sich bei den Fesselungsbedingungen immer um real sichtbare, tradierte und codifizierte – teilweise auch imaginierte – Konstruktionen von Eindeutigkeit und Kontrolle der Beobachtung. Sie bestimmen die Logik der Beobachtung und lassen alles das, was der Beobachtung nicht dienlich ist, als störende oder unwesentliche Bedingung herausfallen.
- Die Wissenschaft ist dafür verantwortlich, den methodologischen Ort der Komplexitätsreduktion anzugeben und weiterzuvermitteln. Sie selbst schützt sich sehr oft mit den aufgestellten wissenschaftlichen Postulaten, was zugleich eine Abwehr im Blick auf die inhärente Subjektivität, die aller verhaltenswissenschaftlichen Forschung innewohnt, sicherstellt.
Das Rosenhan-Experiment belegt das Scheitern dieser vier Strategien recht deutlich. Es zeigt, dass die Zuschreibungen von gesund und krank gar nicht für die subjektiven Beobachtungen durchgehalten werden. Es erschüttert damit aber auch unser Selbstverständnis gegenüber der Verwaltung von Verrücktheit. Es zeigt auch, dass die Vereinfachung des Problems hier insbesondere technisch, d.h. durch Tablettenausgabe nach der Methode Versuch und Irrtum gelöst wurde. Die Logik der Krankenhäuser reproduzierte schließlich die Logik der unterstellten Krankheit. Wer einmal in solchen Institutionen gefangen ist, der sieht auch gar keinen Ausweg mehr, denn die Gefahr, dass einer der eingewiesenen Scheinpatienten doch „irre“ sein könnte und irgend etwas anstellen würde, was dann demjenigen zur Last gelegt wird, der ihn nicht aufgenommen hat, stellt jene imaginierte Konstruktion eines abwehrenden, ängstlichen Umgangs mit Abweichungen von der Norm dar, die sich auf genügend Tatsachen berufen kann. Hier schlägt die zu enge Beobachtungslogik zu: Zwar ist jeder Mensch ein anderer, ein Subjekt, aber als vermeintlich Kranker ist er unter die Kategorie Krankheit verdinglicht, und die Gesellschaft hat nunmehr ihr Recht, ihn eines Teils seiner Subjektivität zu berauben. Die Wissenschaft, hier ausgedrückt durch die Ärzteschaft, weiß sich ihrer Methoden so sicher, dass sie die wenigste Zeit mit den Patienten verbringt. Ihr reichen offensichtlich schon kleine Beobachtungen aus, um sich in ihrer Aufgabe und Rolle bestätigt zu sehen.
Im Rosenhan-Experiment ging es den Untersuchern darum zu zeigen, dass die Wirklichkeit immer eine Konstruktion im Kopfe der Beobachter ist. Dies ist eine fundamentale Einsicht der Beziehungslogik. Aber zugleich zeigt das Experiment eine Schwierigkeit unserer Gesellschaft an, die alle betrifft, die mit Verhalten von Menschen beruflich zu tun haben. Es zeigt, dass die Beobachterpositionen nicht beim Punkte Null, bei irgendeiner fiktiven Vorurteilslosigkeit beginnen, sondern immer schon an das gelernte Konstrukt einer Wissenschaft, einer Institution, gesellschaftlich konstruierter Interessen und Rollen usw. geknüpft sind, so dass, wie das Milgram-Experiment uns lehren konnte, gehöriger Widerstand dazu gehört, sich den gängigen Beobachtungsmodellen zu widersetzen.
1.5. Probleme einer Meta-Logik
Nun erhebt sich die Frage, was geschehen müsste, um die Beziehungslogik auf eine Ebene zu heben, in der über das gegenseitige Verhalten metakommuniziert werden könnte (vgl. auch Kapitel III.2.3.3.).
Zunächst sind wir in unserer Beobachterrolle ja durchaus in der Lage, über alle hier genannten Beispiele zu metakommunizieren, indem wir uns unserer eigenen Rolle gegenüber diskursiv verhalten und diese im Kontext mit anderen Beobachtern zur Disposition stellen. „Wenn wir Kommunikation nicht mehr ausschließlich zur Kommunikation verwenden, sondern um über die Kommunikation selbst zu kommunizieren ..., so verwenden wir Begriffe, die nicht mehr Teil der Kommunikation sind, sondern (im Sinne des griechischen Präfix meta) von ihr handeln.“ (Watzlawick 1985 a, 41 f.) Wir haben allerdings das Problem, dass wir nur über unsere Sprache verfügen, die mit den Begriffen, die wir auch in der Logik erster und zweiter Ordnung gebrauchen, arbeiten. Metakommunikation ist nichts anderes als der überwiegend sprachliche Versuch, uns gedanklich mit jenen Beobachtungen auseinanderzusetzen, die wir machen, ohne uns dabei von den Fesseln jener Bedingungen gefangen nehmen zu lassen, mit denen wir es bisher oder scheinbar selbstverständlich zu tun haben.
Nehmen wir das Rosenhan-Experiment, so zeigt es aus der Sicht einer Psycho-Logik die wesentliche Konstruiertheit von Aussagen über gesund oder krank an. Damit aber die Patienten selbst zur Metakommunikation mit den Ärzten oder dem Pflegepersonal hätten gelangen können, müsste die klinische Arbeit in ihrer bisherigen Form aufgelöst werden. Das Argument eines jeden Gesprächsteilnehmers müsste gleichermaßen gehört und beachtet werden, so dass nicht mehr zu unterscheiden wäre, wer denn nun der Verrückte oder der Normale sei. Dies ist aber – systemimmanent betrachtet – unmöglich, weil es die Institution, die aus der Behauptung ihrer Vernunft die Unvernunft benötigt, um sich abzugrenzen, auflösen würde. Was würde solche Auflösung voraussetzen?
Zuerst müssten sich die Sichtweisen ändern, indem erstens die eigene Konstruktion von Wirklichkeit in ihrem konstruktiven Charakter erkannt und wechselseitig anerkannt wird; zweitens die Bedeutung der Wechselwirkung zwischen Patient und Arzt bzw. Pflegern in ihrer Bedeutung für die jeweiligen Konstruktionen bemerkt und reflektiert wird; drittens beachtet wird, dass der nun einsetzende Vorgang der Metakommunikation sich nicht bloß im Kopfe abspielt, sondern auch Gefühlslagen und die gesamte Persönlichkeit betrifft, was ein durchaus widersprüchliches Erleben produzieren kann. Gerade diese Widersprüchlichkeit aber ist zu thematisieren, wenn metakommuniziert werden soll.
Die Bedingung eins können wir auch in Kliniken noch partiell erfüllen. Es heißt ja oft ironisch bei Ärzten, wer sind hier nun die eigentlich Verrückten – die oder wir? Aber diese Bedingung bleibt meist nur für kurze Zeit ertragbar, dann will der vermeintlich Besserwissende doch sein Recht behalten. Die Wechselwirkung als Bedingung zwei anzuerkennen ist abstrakt betrachtet recht schnell zu leisten, aber dies bleibt meist folgenlos. Sollten die Machtstrukturen der Klinik aufgehoben werden, so wären wir in einer Bewegung der Antipsychiatrie, die all das in Frage stellt, was der Mächtige, d.h. hier das wissende System Psychiatrie, sich erarbeitet hat und von dem seine Existenz abhängt. Mag das Unbehagen an solchen Institutionen auch noch so groß werden, bevor sie sich selbst besiegen, muss ihre Unwirklichkeit, ihre Ineffizienz sichtbar hervortreten. So bleibt die dritte Bedingung, die in den therapeutischen Sitzungen der Klinik durchaus erfüllt werden kann, wenn der Therapeut gesteht, dass er es eigentlich auch nicht besser weiß und gefühlsmäßige Widersprüche ihm verständlich sind. Doch für ein Mitglied einer Organisation, der in der arbeitsteiligen Welt die Aufgabe zufällt, die Menschheit vor sich selbst zu schützen, weil Angst und Abwehr der scheinbar Normalen (d.h. der funktionsfähigen Bürger) jede Form von Anderssein (also Ver-Rückte jeder Art) in einer zeitökonomisch und technisch gestalteten Moderne nicht ertragen, für ein solches Mitglied wird Metakommunikation zur Enklave, zur Inselbedeutung einer therapeutischen Sitzung. Immerhin kann dies durchaus dem Patienten helfen – aber das System nicht grundsätzlich verändern.
Der kleine Albert konnte sich nicht wehren. Die Leute im Milgram-Experiment hätten sich wehren können. Die Verrückten in der Psychiatrie haben sich bereits auf ihre Art gewehrt, indem sie der Gesellschaft verweigerten, normal zu sein. Wir als Beobachter tun gut daran, den logischen Ort unserer Argumente immer zu überprüfen:
- als enge Beobachtungslogik immer dann, wenn wir das eine aus dem anderen folgerichtig und möglichst eindeutig ableiten wollen, weil wir daraus Sicherheit gewinnen, obwohl wir bei lebendigen Vorgängen so immer zu kurzschlüssig verfahren;
- als Beziehungs- oder Psycho-Logik immer dann, wenn wir bemerken, dass das Wechselspiel zwischen den Menschen ebenso Verhalten produziert wie das dingliche Verhalten, wenn wir also bemerken, dass die enge Logik um eine Psycho-Logik zu erweitern ist, was Absolutheit, Dogmatik, Unumstößlichkeit von richtig und falsch, Behauptung von besser und schlechter nicht nur relativiert, sondern grundsätzlich unsicher macht, weil wir aus einer immer wieder neuen Blickrichtung uns alles als anders entdecken können. Blieben wir in dieser Logik, so müssten wir wahrscheinlich verrückt werden, weil wir uns bei genauem Hinsehen gar nicht mehr für einfache Lösungen entscheiden könnten.
Bei näherem Hinsehen erweist sich jede Meta-Logik als fragwürdig: Wir üben sie allenfalls als Kommunikation über unsere Kommunikation, und nur dies nenne ich Meta-Kommunikation, aber eine Logik über einer Logik im Sinne der höheren oder notwendig besseren Erklärung gibt es hier nicht. Ich schließe damit aus, dass es jenen Meta-Beobachter gibt, der aus einer höchsten Position uns seine Logik als richtiges Weltbild unterbreiten kann. Diese Ausgangshypothese wird maßgeblich bei der Entwicklung einer konstruktivistischen Beziehungs-Logik sein.
1.6. Beobachtung erster oder zweiter Ordnung? – Zur Situierung der
Beziehungswirklichkeit
In der konstruktivistischen Literatur hat sich die Unterscheidung zwischen einem Beobachter erster und zweiter Ordnung eingebürgert. In einer ersten Ordnung beobachtet sich der Beobachter selbst, er entspricht dem, was wir Selbstbeobachter nennen. Dies können wir auch so verstehen, dass die jeweilige Verständigungsgemeinschaft festlegt, was Kontext und Inhalt von Beobachtungen ist. Aber dies ist schon widersprüchlich: Bin ich als Subjekt in meinen scheinbar rein subjektiven Bemühungen nicht der eigentliche Beobachter erster Ordnung? An meine Seite tritt dann die Verständigung mit Anderen, was meine Beobachtung in eine zweite Welt hebt: Die Verständigung, die ich in einer Gemeinschaft von Beobachtern finde. Diese korrigiert als Gemeinschaft von Fremdbeobachtern meine subjektiven Beobachtungen, sie verobjektiviert sie.
Aus diesem Grund meint Luhmann, dass Erkenntnistheorie nur als Beobachtung zweiter Ordnung betrieben werden kann. Aber das ist bereits eine Vereinfachung. Denn die Erkenntnistheorie umgreift eine Vielzahl gegensätzlicher Verständigungsgemeinschaften, die sich alle selbst als Fremdbeobachter gegenüberstehen müssten, um sich als Beobachtung zweiter Ordnung zu sehen. Eigentlich müssten wir hier dann wohl schon von dritter oder n-ter Ordnung sprechen:
- Als erste Ordnung der Beobachtung erscheint der Beobachter selbst (Selbstbeobachtung), wobei das Problem auftritt, dass er dies in Form reiner Subjektivität im Blick auf Wissen und Wahrheit nicht sein kann, da Beobachtungen immer schon Verständigungsgemeinschaften voraussetzen. Sind diese nun auch Beobachter erster Ordnung? Sie sind dies allenfalls aus dem Blick einer fremdbeobachtenden anderen Verständigungsgemeinschaft, die kritisch Beobachtungen über diese Beobachtungen betreibt. Für den einzelnen Beobachter aber erscheinen sie schon als Beobachtung zweiter Ordnung, weil sie Beobachter seines Beobachtens sind.
- Als zweite Ordnung der Beobachtung gelten damit schon widersprüchliche Verständigungsansprüche: Einerseits die Verständigungsgemeinschaft selbst, die aber nur als universalisierte eindeutig auf einer zweiten Ordnung stehen könnte. Da jedoch gerade die Universalisierung von Verständigungsgemeinschaften sich nicht bewahrheiten lässt, zerfällt auch die Beobachtung zweiter Ordnung in eine Pluralität von Interessen, Macht und Gegensätzen selbst innerhalb einer Verständigungsgemeinschaft, die sich ja nicht in allen Punkten einig sein muss. Andererseits gibt es den pluralen Kampf um Verständigung, der immer wieder Zwischenprodukte erzeugt, die sich zu (unzulässigen, aber pragmatisch wirksamen) Verallgemeinerungen einer Beobachtung zweiter Ordnung aufschwingen: „Wissenschaftlich zulässig für alle Verständigungsgemeinschaften erscheint“, „wissenschaftlich anerkannt wird“, „wissenschaftlich verworfen ist“, allesamt Forderungen an eine Beobachtung zweiter Ordnung, die das regelt, kontrolliert und diszipliniert, was Beobachter erster Ordnung in ihrem Rahmen der Beobachtungen erklären, legitimieren, verwerfen.
- Als dritte bis n-te Ordnung müssen wir aus den eben skizzierten Widersprüchen nun jene pluralen Verständigungsgemeinschaften anerkennen, die im Nach- und Nebeneinander dieser Ordnungen keinen Schlusspunkt setzen können, kein formal vereinfachendes Schema gewinnen (wie z.B. Luhmann), sondern fortgesetzt widersprüchlich sich äußern.
- In solcher Beobachtungsordnung ist die Beziehungswirklichkeit situiert. Es ist eine bezogene Wirklichkeit, die in zirkulärer Verwobenheit, singulärer Aktion, individueller Deutung und zugleich unter Ansprüchen von Verständigung als Verallgemeinerung bestimmter Gruppen(interessen) von Menschen steht. Sie ist darin komplizierter als die Unterscheidung von Beobachtung erster und zweiter Ordnung nach Luhmann und anderen Konstruktivisten:
- Beobachter erscheinen immer als Fremd- und Selbstbeobachter im Blick auf die reflektierte oder unbewusst übernommene Vorgängigkeit einer Verständigungsgemeinschaft. Dabei sind die Beobachter der Beobachter der Beobachter usw. nie in eine Abgeschlossenheit oder Ausschließlichkeit transformierbar, die Verständigungsgemeinschaften nicht auf die Gültigkeit einer Verständigungsgemeinschaft begrenzbar, wenn konstruktivistisch offen kommuniziert werden soll.
- Die Logik der Beobachtung einer ersten Ordnung, die von einer zweiten Ordnung als Erkenntniskritik bezeichenbar und kritisierbar wird, stellt sich im bisherigen Konstruktivismus als ein Versuch der Aufrechterhaltung von erkenntnistheoretischer Schärfe dar. Dazu muss sie logisch vorgehen und eine psychologische Infragestellung vermeiden. Nun erweist sich aber gerade die Psycho-Logik als Basis der Beziehungswirklichkeit, dabei als zentrales Konstrukt der Lebensformen und Beziehungen der Menschen. Aus der Beobachtungswelt der engeren Logik mit ihrer ersten und zweiten Ordnung gelangen wir nunmehr in eine andere Ordnung überhaupt: die Beziehungswirklichkeit. In dieser Wirklichkeit gelten andere Maßstäbe der Logik und der Schärfe der Erkenntnis. Sofern diese Wirklichkeit nicht aus dem wissenschaftlichen Denken ausgeschlossen werden soll, was immer fatale Folgen für die lebensbezogene Relevanz von Wissenschaft hat, bedarf die wissenschaftliche Arbeit einer neuen Fundierung. Dies zu erörtern und möglichst präzise festzuschreiben wird Aufgabe der nachfolgenden Argumentationen sein.
- Gleichwohl bleibt ein Widerstreit: Die Beziehungswirklichkeit ist bis heute ein Stiefkind der Wissenschaften. In den technischen und naturwissenschaftlichen Setzungen des materiellen Fortschritts und verdinglichender Methoden erscheint dies noch als verständlich, wenngleich die zunehmenden Risiken solcher Verabsolutierung uns immer deutlicher vor Augen treten. In den Verhaltens- und Humanwissenschaften hingegen wird eine solche Herangehensweise immer unglaubwürdiger und sie isoliert sich – auch als Beobachtung zweiter Ordnung – zunehmend von den Lebensformen der Menschen. Hier riskiert die Wissenschaft ihre eigene Selbstaufhebung mangels konkreter Anwendungen. Wenn die Beobachtung erster und zweiter Ordnung in der kausalen Enge von funktionalen Modellen, entsubjektivierten und von der Lebenswelt abgekoppelten Kunstwirklichkeiten von Wissenschaftlern (exemplarisch dafür scheint mir der Ansatz von Luhmann zu sein), in den bloßen Selbstrekrutierungs- und Karriereformen der Wissenschaften als selbstreferentem System wurzelt, dann wird dies zu einem unberechenbaren Risiko für die Wissenschaft selbst. Welche Lebensform mit welchen Beziehungsmustern will sich eine solche Wissenschaft auf Dauer leisten?
1 Der andere mit kleinem a ist jener andere, den wir aus unserer ureigensten Sicht innerlich, imaginär vorstellen, seine Bedeutung bleibt uns oft unklar oder unbewusst; der Andere mit großem A ist ein tatsächlicher, äußerer, symbolischer Anderer, der von einem Beobachter in einer bestimmten Bedeutung gesehen wird. Zur Herleitung der Unterscheidung, die nachfolgend immer wieder auftreten wird, vgl. insbesondere Band 1, Kapitel II.3.5.
2 Solche strikte Reflexion strebt insbesondere die Sprachphilosophie (vgl. Kuhlmann 1985) an, wie weiter oben erörtert wurde. Vgl. insbes. Bd.1, Kapitel II.1.3.
3 George Devereux hat diese Problematik ausführlich beschrieben, indem er hervorhob, dass nicht nur das Verhalten des jeweils beobachteten Objekts relevant ist, sondern auch alle Störungen seitens des Beobachters und das Verhalten dieses Beobachters reflektiert werden müssen, wenn hinreichend begründet etwas über das Verhalten von Beobachteten ausgesagt werden soll. Vgl. Devereux (1967).
4 Dies ist auch das Kennzeichen der Professoren, deren Berufung stets staatlich diszipliniert und kontrolliert wird. Ihr Grundrecht auf Freiheit von Forschung und Lehre besteht nur in diesem Kontext.
5 Die Beobachterposition im Prozess der Kränkungen von Erkenntnis wurde ausführlich in Band 1 behandelt.
6 Dies gilt seit dem 17. Jahrhundert insbesondere durch die Vermittlung des Werkes von Comenius, der in seiner „Großen Didaktik“ und anderen Studien immer wieder die Notwendigkeit herausstellt, Motivation und Wettstreit der Kinder als lernfördernd einzusetzen.
7 Vgl. zur ausführlichen Darlegung dieses Beispiels Lacan (1986, III, 103 ff. und 1980, 365 ff.).
8 Wobei ich mich teilweise von Lacans (1986, III, 103 ff. und 1980, 365 ff.) Überlegungen leiten lasse, insgesamt aber eine neue Interpretation entwickle.
9 Zur näheren Begründung der logischen Figur und möglicher Einwendungen vgl. Lacan (1986, 105 ff.).
10 Lacan beschreibt die logischen Möglichkeiten, das Beispiel auch mit einer höheren Zahl von Teilnehmern durchführen zu lassen (1986, III, 119 f.). Doch die Bedingungen des Zweifelns nehmen bei jedem weiteren Teilnehmer zu, so dass die zeitliche Objektivierung immer schwieriger zu begreifen sein wird, je mehr Menschen in das Experiment einbezogen werden.
11 Vgl. zur Problematik empirischer Erkenntnisgewinnung z.B. Devereux (1967), Feyerabend (1978, 1981, 1986).
12 Eine anschauliche Sammlung zur Einführung in klassische Experimente der Psychologie findet sich etwa bei Schwartz (1991).
13 Vgl. dazu auch einführend Schwartz (1991, S. 171 ff.).
14 Zu den Variationen und Differenzierungen des Versuchs vgl. Milgram (1982).
|
|
>> zurück zum Inhaltsverzeichnis und zur Auswahl der Kapitel |
|
|